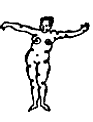 heologie
Der letzte in unsere Betrachtung eingehende Fall nun wäre, daß die
unter der vorigen Nummer beschriebene, magische Einwirkung auch noch nach
dem Tode ausgeübt werden könnte, wodurch dann eine eigentliche Geistererscheinung,
mittelst direkter Einwirkung, also gewissermaaßen die wirkliche, persönliche
Gegenwart eines bereits Gestorbenen, welche auch Rückwirkung auf ihn zuließe,
Statt fände. Die Ableugnung a priori jeder Möglichkeit dieser Art und das
ihr angemessene Verlachen der entgegengesetzten Behauptung kann auf nichts
Anderm beruhen, als auf der Ueberzeugung, daß der Tod
die absolute Vernichtung des Menschen sei; es wäre denn, daß sie sich auf
den protestantischen Kirchenglauben stützte, nach welchem Geister darum
nicht erscheinen können, weil sie, gemäß dem während der wenigen Jahre
des irdischen Lebens gehegten Glauben oder Unglauben, entweder dem Himmel,
mit seinen ewigen Freuden, oder der Hölle, mit
ihrer ewigen Quaal, gleich nach dem Tode, auf immer zugefallen seien, aus
Beiden aber nicht zu uns heraus können; daher, dem protestantischen Glauben
gemäß, alle dergleichen Erscheinungen von Teufeln,
oder von Engeln, nicht aber von Menschengeistern,
herrühren; wie dies ausführlich und gründlich auseinandergesetzt hat Lavater,
de spectris, Genevae 1580, pars II, cap. 1 et 4.
heologie
Der letzte in unsere Betrachtung eingehende Fall nun wäre, daß die
unter der vorigen Nummer beschriebene, magische Einwirkung auch noch nach
dem Tode ausgeübt werden könnte, wodurch dann eine eigentliche Geistererscheinung,
mittelst direkter Einwirkung, also gewissermaaßen die wirkliche, persönliche
Gegenwart eines bereits Gestorbenen, welche auch Rückwirkung auf ihn zuließe,
Statt fände. Die Ableugnung a priori jeder Möglichkeit dieser Art und das
ihr angemessene Verlachen der entgegengesetzten Behauptung kann auf nichts
Anderm beruhen, als auf der Ueberzeugung, daß der Tod
die absolute Vernichtung des Menschen sei; es wäre denn, daß sie sich auf
den protestantischen Kirchenglauben stützte, nach welchem Geister darum
nicht erscheinen können, weil sie, gemäß dem während der wenigen Jahre
des irdischen Lebens gehegten Glauben oder Unglauben, entweder dem Himmel,
mit seinen ewigen Freuden, oder der Hölle, mit
ihrer ewigen Quaal, gleich nach dem Tode, auf immer zugefallen seien, aus
Beiden aber nicht zu uns heraus können; daher, dem protestantischen Glauben
gemäß, alle dergleichen Erscheinungen von Teufeln,
oder von Engeln, nicht aber von Menschengeistern,
herrühren; wie dies ausführlich und gründlich auseinandergesetzt hat Lavater,
de spectris, Genevae 1580, pars II, cap. 1 et 4.
Die katholische Kirche hingegen,
welche schon im 6. Jahrhundert, namentlich durch Gregor den Großen, jenes
absurde und empörende Dogma, sehr einsichtsvoll, durch das zwischen jene
desperate Alternative eingeschobene Purgatorium [Fegfeuer] verbessert hatte,
läßt die Erscheinung der in diesem vorläufig wohnenden Geister, und ausnahmsweise
auch anderer, zu; wie ausführlich zu ersehn aus dem bereits genannten Petrus
Thyraeus, de locis infestis, pars I, cap. 3, sqq. Die Protestanten
sahen, durch obiges Dilemma, sich sogar genöthigt, die Existenz des Teufels
auf alle Weise festzuhalten, bloß weil sie zur Erklärung der nicht abzuleugnenden
Geistererscheinungen seiner durchaus nicht entrathen konnten: daher wurden,
noch im Anfang des vorigen Jahrhunderts, die Leugner des Teufels Adaemonistae
[Dämonenungläubige] genannt, fast mit dem selben pius horror [frommen
Schauder], wie noch heut zu Tage die Atheistae: und zugleich wurden
demgemäß, z. B. in C. F. Romani schediasma polemicum, an dentur spectra,
magi et sagae, Lips. 1703, gleich von vorn herein die Gespenster
definirt als apparitiones et territiones
Diaboli externae, quibus corpus, aut aliud quid in sensus incurrens
sibi assumit, ut homines in festet [äußere Erscheinungen und Schreckgestalten
des Teufels, in denen er den Leib oder etwas anderes mit den Sinnen Wahrnehmbares
annimmt, um die Menschen zu beunruhigen]. Vielleicht hängt sogar es hiemit
zusammen, daß die Hexenprocesse, welche bekanntlich
ein Bündniß mit dem Teufel voraussetzen, viel häufiger bei den Protestanten,
als bei den Katholiken gewesen sind. - Jedoch von dergleichen mythologischen
Ansichten absehend sagte ich oben, daß die Verwerfung a priori der Möglichkeit
einer wirklichen Erscheinung Verstorbener allein auf die Ueberzeugung,
daß durch den Tod das menschliche Wesen ganz und gar zu nichts werde, sich
gründen könne. Denn so lange diese fehlt, ist nicht abzusehn, warum ein
Wesen, das noch irgendwie existirt, nicht auch sollte irgendwie sich manifestiren
und auf ein anderes, wenn gleich in einem andern Zustande befindliches,
einwirken können. Daher ist es so folgerecht, wie naiv, daß Lukianos,
nachdem er erzählt hat, wie Demokritos
sich durch eine ihn zu schrecken veranstaltete Geistermummerei keinen Augenblick
hatte irre machen lassen, hinzufügt: adeo persuasum habebat, nihil
adhuc esse animas a corpore separatas. [So fest war er davon überzeugt,
daß die Seelen, wenn sie den Körper
verlassen haben, nichts mehr seien.] Philops. 32. - Ist hingegen
am Menschen, außer der Materie, noch irgend etwas Unzerstörbares;
so ist wenigstens a priori nicht einzusehn, daß jenes, welches die
wundervolle Erscheinung des Lebens hervorbrachte, nach Beendigung derselben,
jeder Einwirkung auf die noch Lebenden durchaus unfähig seyn sollte. -
Schopenhauer, Versuch über Geistersehen, in (schop)
Theologie (2) Wie Ihnen wohl nicht
unbekannt ist, bin ich viel gereist. Das hat mir gestattet, die Behauptung
zu erhärten, daß Reisen immer mehr oder minder eine illusorische Angelegenheit
ist, daß es nichts Neues unter der Sonne gibt, daß alles ein und dasselbe
ist, und so weiter, daß aber widersprüchlicherweise jedwede Skepsis, Überraschungen
und neuen Dingen zu begegnen, unbegründet ist: in Wahrheit ist die Welt
unerschöpflich. Als Beweis des Gesagten brauche ich nur an den Pilgerglauben
zu erinnern, den ich in Kleinasien bei einem Hirtenvolk gefunden habe,
das sich mit Schaffellen bekleidet und Erbe des alten Reichs der Heiligen
Drei Könige aus dem Morgenland ist. Diese Leute glauben an den Traum. »Im
Augenblick des Einschlafens«, erklärten sie mir, »kommst du je nach deinen
während des Tages vollbrachten Taten in den Himmel oder in die Hölle.«
Wenn jemand einwände: »Ich habe nie einen Schläfer aufbrechen sehen; meiner
Erfahrung gemäß bleibt er liegen, bis er geweckt wird;« würden sie erwidern:
»Der Wunsch, an nichts zu glauben, bringt dich dazu, deine eigenen Nächte
zu vergessen wer hat nicht angenehme Träume und entsetzliche Träume gekannt?
— und den Traum mit dem Tod zu verwechseln. Ein jeder von uns ist Zeuge,
daß es für den Träumer eine andere Welt gibt; für die Toten ist das Zeugnis
ein anderes: sie bleiben wo sie sind und verwandeln sich zu Staub.« -
H. Garro, Tout lou Mond (1918), nach (bo4)
Theologie (3) Als Theologe nutzte der
Dominikaner Albertus seine einzigartige Faktenkenntnis über das
Leben der Tiere zur Untermauerung des Glaubens. So pocht er in seiner »Mystischen
Theologie« auf die Bedeutung des Intellekts für den Glauben
(fides), indem er festhält, das Sehvermögen mancher Kreatur, so
der Fledermaus, werde vom Sonnenlicht außer Kraft gesetzt, während andere,
zum Beispiel die Menschen, zwar kurz in die Sonne blicken könnten, da die
Augen aber zu schwach seien, immerfort blinzeln müßten. Wieder andere,
wie der Steinadler, verfügten dagegen über eine solche Sehkraft, daß sie
mitten ins Sonnenlicht hineinschauen könnten. In ähnlicher Weise sei das
geistige Schauen jener Menschen, die durch irdische
Leidenschaften und sinnliche Bilder niedergehalten
würden, rein materieller Art und dadurch völlig unempfänglich für göttliche
Erscheinungen. So wie ihr Sehen sich jedoch von diesen Dingen weg und der
geistigen Schau zuwende, werde es immateriell, und wenn es ihnen auch noch
vor den Augen flimmere, da sie das Göttliche aus der Ferne erblickten,
nach »Vernunftprinzipien«, werde sich doch der Blick, durch das Licht des
Glaubens gestärkt, nach und nach festigen.
In seiner Theologie folgt Albertus, doctor universalis, den Worten
des heiligen Paulus im ersten Korintherbrief und kommt auch Dürers unausgesprochenem
Glauben nahe, Gottes Wille und Werke würden in der Natur offenbar: »Wir
sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort«, doch nähern wir
uns, indem wir der Schöpfung nahekommen, dem Schöpfer und bereiten uns
so darauf vor, ihn »von Angesicht zu Angesicht« zu schauen. In Liebenden,
so Albertus, rege sich körperliche Leidenschaft,
wenn sie die geliebte Person mit den »Augen des Herzens« anschauten. -
Colin Eisler, Dürers Arche Noah. Tiere und Fabelwesen im Werk von Albrecht
Dürer. München 1996 (zuerst 1991)
Theologie (4) Das Wort Stercoranisten
oder Sterkorarier ist in der letzten Ausgabe der Encyclopaedia
Britannica nicht zu finden; aber in der Ausgabe von 1841 ist das Wort
folgendermaßen erklärt: »Stercorarianer oder Stercoranisten, gebildet aus
stercus (lat. Kot), ein Name, den die Anhänger der römischen Kirche
ursprünglich solchen Leuten gaben, die annahmen, daß die Hostie der Verdauung
und allen weiteren Folgen unterworfen wäre, gerade wie andere Nahrung.«
Diese Erklärung ist in Rees' Cyclopaedia of Arts, Sciences and Literature
[1802] wörtlich übergegangen.
Der Streit über den Stercoranismus begann im Jahre 831 infolge des Erscheinens
einer theologischen Abhandlung eines Mönches namens Paschasius Radbertus.
»Die grob-sinnliche Auffassung von der Gegenwart des Leibes Christi
im Sakrament, nach der dieser Leib gegessen, verdaut und wie jede andere
Nahrung entleert wird, ist schon alt, wenn man sie auch nicht bei Origenes
und vielleicht auch nicht bei Rhabanus Maurus findet. Sie entstand sicherlich
bei einer Klasse von ketzerischen Lehrern aus der Zeit oder früher als
Rhabanus Maurus, den Paschasius Radbertus verdammt« [von Mosheim, 1832].
»Es ist daher gottlos, bei diesem Mysterium
anzunehmen, daß es bei der Verdauung der anderen Speisen in Kot verwandeln
würde« [Radbertus].
Er wendet indessen auf seine Gegner den Ausdruck »Stercoranisten« noch
nicht an. Der erste, der das Wort gebraucht, ist der Kardinal Humbert,
und zwar tut er es in einer Streitschrift gegen Nicetas Pectoratus, die
zur Verteidigung des Azytimismus geschrieben ist, usw. Aus dieser
Quelle ging das Wort in den allgemeinen Gebrauch über [Schroeckh, 1772;
McClintock und Strong, 1880; Schaff-Herzog, 1881].
»Diesen Namen haben einige Schriftsteller denjenigen gegeben, die dachten,
daß die Symbole des Abendmahles der Verdauung und allen ihren Folgen ebenso
unterworfen wären wie die anderen körperlichen Nahrungsmittel. Das Wort
ist vom lateinischen stercus (Kot) abgeleitet. Ob diese Ketzerei
überhaupt vorhanden war, ist nicht allgemein anerkannt.« - (bou)
Theologie (5) Die Erdmenschen
im Untersuchungsausschuß waren in der Mehrheit und stimmten dafür, daß
man jegliche Tätigkeit in Rautavaaras künstlich belebtem Hirn abbrechen
sollte. Das war für uns enttäuschend, aber uns standen keine Rechtsmittel
zur Verfügung.
Wir hatten den Beginn eines absolut erstaunlichen wissenschaftlichen
Experiments gesehen: wie die Theologie einer Rasse auf die einer anderen
aufgepfropft wird. Das Abschalten des Hirns dieses Erdmenschen war wissenschaftlich
eine Tragödie. So war zum Beispiel, was die grundlegende Beziehung zu Gott
betraf, die Auffassung der Erdmenschen der unsrigen diametral entgegengesetzt.
Dies muß man selbstverständlich dem Umstand zuschreiben, daß sie eine somatische
Rasse sind, wir dagegen Plasma. Sie trinken
das Blut ihres Gottes; sie essen sein Fleisch; so
werden sie unsterblich. Für sie ist das in keiner
Weise skandalös. Sie finden es vollkommen natürlich. Und doch ist es für
uns entsetzlich. Gläubige essen und trinken ihren Gott? Grauenvoll für
uns; absolut grauenvoll. Ein Greuel, eine Schande
- eine einzige Abscheulichkeit. Das Höhere sollte sich immer vom Niedrigeren
ernähren; der Gott sollte die Gläubigen verzehren. - Philip
K. Dick, Der Fall Rautavaara. In: Der Fall Rautavaara. Sämtliche SF-Geschichten
Band 10. Zürich 2000 (zuerst 1980)
Theologie (6) Mein Nachbar kam begeistert
zurück. Was für ein Mann! Diese Augen! Und diese Ruhe ... Endlich mal einer,
der einem zuhört.
Vom Konvertieren kam er ab. Jetzt wollte er Theologie studieren. Im Testament
strich er bedeutsame Stellen an. Die Hauptschwierigkeiten des Studiums lägen
im Sprachlichen, sagte der Pfarrer zu ihm.
-
Walter Kempowski, Im Block. Frankfurt am Main 1972 (zuerst 1969)
Theologie (7) Atomistische
Theologie ist mir ein Greuel. Ich kann die Geschichte der Taube lesen, die aus
der Arche entlassen wurde und nicht wiederkam, und frage nicht, wie sie denn
ihren Gesellen gefunden hat, der zurückgeblieben war; ich lese von der Auferstehung
des Lazarus, und suche nicht zu erkunden, wo seine Seele in der Zwischenzeit
weilte; mache auch keinen juristischen Casus daraus, ob sein Erbe die durch
den Tod des Erblassers ihm zugefallenen Güter rechtmäßig hätte behalten können,
während dieser selbst, obgleich ins Leben zurückgekehrt, jeglichen Anspruch
und Rechtstitel auf seinen früheren Besitz verwirkt haben würde. Ob Eva aus
Adams linker Seite geformt worden sei, ist für mich kein Anlaß zum Disput, denn
bislang fehlt mir die letzte Gewißheit darüber, wo denn die rechte Seite des
Menschen liegt und ob die Natur überhaupt einen derartigen Unterschied kennt;
daß sie aus Adams Rippe erbaut worden ist, glaube ich wohl, doch ohne die Frage
anzuschließen, wer mit dieser Rippe am Jüngsten Tag auferstehen wird. Ich achte
es für eine müßige Spekulation, ob Adam ein Hermaphrodit gewesen sei, wie die
Rabbiner aus dem Buchstaben der Schrift herausdisputieren wollen, da die Existenz
eines Zwitters, ehe es ein Weib gab, oder die Zusammensetzung zweier Geschlechter,
ehe das zweite in die Welt gesetzt war, gegen die Vernunft geht. Ebenso steht
es mit der Frage, ob die Welt im Frühling, Sommer oder Herbst erschaffen worden
sei — sie ist in allen miteinander erschaffen; denn in welchem Zeichen die Sonne
auch steht, die vier Jahreszeiten sind immer und wirklich vorhanden. Es liegt
in der Natur dieses Leuchtgestirns, die verschiedenen Zeiten des Jahres zu sondern:
gleichzeitig erzeugt es sie alle, wenn man die Welt als ganze nimmt, nacheinander
aber in ihren einzelnen Teilen. Es gibt ganze Bündel kurioser Fragen, die in
der Philosophie wie in der Theologie aufgeworfen und von scheinbar höchst gelehrten
Köpfen fleißig erörtert werden, dabei jedoch nicht einmal unserer müßigen Stunden
wert sind, geschweige denn unserer ernsthaften Studien — lauter Raritäten, die
einzig dazu taugen, in Pantagruels Bibliothek
eingereiht und mit Tartaretus De Modo Cacandi
im Verein gebunden zu werden. - Sir Thomas Browne, Religio medici. Berlin 1976 (zuerst 1642)
Theologie (8) Es sei mir unverständlich
geblieben: wie die frommen Juden sich spalten, nach ihren Rebbes.
Warum hängen sie an den Rebbes? Es gibt, habe ich im Westen gehört, doch nur
ein Judentum, einen Glauben. Sie lächeln freundlich am Tisch; einer nickt bekräftigend:
«Eine gute Frage.» Der Rebbe ruht in sich, dann sieht er mich mit seinen sehr
sanften Augen an:
«Alle haben dasselbe Ziel, das zu Gott führt. Es gibt ein großes
Land. Ein König herrscht über das Land. Der König kann aber das Land nicht allein
regieren; er braucht Soldaten und Generale. Das sind die Rebbes. Die Rebbes,
worin unterscheiden sie sich. Sie halten sich alle an ein und dasselbe. Ein
Rebbe kann die Thora verstehen hart
oder weich. Man kann die Thora verstehen so und so.
Es gibt eine Thora von ‹Middas haddim›: ich befehle, bis zu einer Thora: ‹Middas
horachim›: ich habe Mitleid. Das ist die Interpretation.
Und wer die Thora hart versteht, hat seine Anhänger; und wer sie weich versteht,
hat seine Anhänger. Und das macht die Zahl der Anhänger. Die Rebbes sind Fromme
und Söhne von Frommen. Jeder wählt sich den Rebbe,
zu dem er Sympathie hat.» - Alfred Döblin, Reise
in Polen. München 1987 (zuerst 1925)
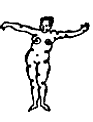 heologie
Der letzte in unsere Betrachtung eingehende Fall nun wäre, daß die
unter der vorigen Nummer beschriebene, magische Einwirkung auch noch nach
dem Tode ausgeübt werden könnte, wodurch dann eine eigentliche Geistererscheinung,
mittelst direkter Einwirkung, also gewissermaaßen die wirkliche, persönliche
Gegenwart eines bereits Gestorbenen, welche auch Rückwirkung auf ihn zuließe,
Statt fände. Die Ableugnung a priori jeder Möglichkeit dieser Art und das
ihr angemessene Verlachen der entgegengesetzten Behauptung kann auf nichts
Anderm beruhen, als auf der Ueberzeugung, daß der Tod
die absolute Vernichtung des Menschen sei; es wäre denn, daß sie sich auf
den protestantischen Kirchenglauben stützte, nach welchem Geister darum
nicht erscheinen können, weil sie, gemäß dem während der wenigen Jahre
des irdischen Lebens gehegten Glauben oder Unglauben, entweder dem Himmel,
mit seinen ewigen Freuden, oder der Hölle, mit
ihrer ewigen Quaal, gleich nach dem Tode, auf immer zugefallen seien, aus
Beiden aber nicht zu uns heraus können; daher, dem protestantischen Glauben
gemäß, alle dergleichen Erscheinungen von Teufeln,
oder von Engeln, nicht aber von Menschengeistern,
herrühren; wie dies ausführlich und gründlich auseinandergesetzt hat Lavater,
de spectris, Genevae 1580, pars II, cap. 1 et 4.
heologie
Der letzte in unsere Betrachtung eingehende Fall nun wäre, daß die
unter der vorigen Nummer beschriebene, magische Einwirkung auch noch nach
dem Tode ausgeübt werden könnte, wodurch dann eine eigentliche Geistererscheinung,
mittelst direkter Einwirkung, also gewissermaaßen die wirkliche, persönliche
Gegenwart eines bereits Gestorbenen, welche auch Rückwirkung auf ihn zuließe,
Statt fände. Die Ableugnung a priori jeder Möglichkeit dieser Art und das
ihr angemessene Verlachen der entgegengesetzten Behauptung kann auf nichts
Anderm beruhen, als auf der Ueberzeugung, daß der Tod
die absolute Vernichtung des Menschen sei; es wäre denn, daß sie sich auf
den protestantischen Kirchenglauben stützte, nach welchem Geister darum
nicht erscheinen können, weil sie, gemäß dem während der wenigen Jahre
des irdischen Lebens gehegten Glauben oder Unglauben, entweder dem Himmel,
mit seinen ewigen Freuden, oder der Hölle, mit
ihrer ewigen Quaal, gleich nach dem Tode, auf immer zugefallen seien, aus
Beiden aber nicht zu uns heraus können; daher, dem protestantischen Glauben
gemäß, alle dergleichen Erscheinungen von Teufeln,
oder von Engeln, nicht aber von Menschengeistern,
herrühren; wie dies ausführlich und gründlich auseinandergesetzt hat Lavater,
de spectris, Genevae 1580, pars II, cap. 1 et 4.










