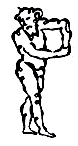 ianist Das
zweite Gemälde in Erskines Zimmer zeigt einen Herrn in voller Größe am Piano
sitzend, im Profil von rechts hinten, nackt bis auf den mit Notenpapier bedeckten
Schoß. Mit der rechten Hand hält er einen Akkord, der von Watt mühelos als der
C-Dur-Grundakkord in seiner zweiten Umkehrung erkannt wurde, während er
mit der anderen die Muschel seines linken Ohrs vergrößert.
Sein rechter Fuß, dem der linke von oben Nachdruck verleiht, tritt mit aller
Macht auf das Forte-Pedal. Den kräftigen Muskeln von Nacken,
Arm, Rumpf, Bauch, Lende, Oberschenkel
und Wade, die wie angestrengte Saiten vorspringen, hatte Mr. O'Connery alle
Fertigkeiten jesuitischen Tastsinns angedeihen lassen. Schweißperlen in so vollendeter
Darstellung, daß sie eines Heem würdig gewesen wären, waren zahlreich über pektorale,
subaxillare und hypogastrische Flächen verteilt. Die rechte Brustwarze,
der ein langes, rotes, einsames Haar entsproß, war im Stadium unverkennbarer
Schwellung, ein reizendes Detail. Der Oberkörper war über die Tastatur
gebeugt, und der Ausdruck des leicht
dem Betrachter zugewandten Gesichts glich dem eines Mannes, der drauf
und dran war, sich nach vielen Tagen eines besonders harten Stuhls zu entledigen,
seine Stirn war nämlich zerfurcht, die Augen waren zugekniffen,
die Nasenlöcher geweitet, der Mund stand halb offen, und der Unterkiefer
hing herab als eine nicht schöner vorstellbare Synthese aus Angst,
Konzentration, Anstrengung, Erregung
und Selbstaufopferung, als eine Illustration der auf ein musikalisches Wesen
ausgeübten außerordentlichen Wirkung der leisen Kakophonie
ferner, sich in den verklingenden Akkord einmischender Obertöne. Mr. O'Connerys
Liebe zum bedeutsamen Detail zeigte sich auch in der Malweise der Zehennägel,
die auffallend üppig wucherten und vom Schmutz zu
strotzen schienen. Auch den Füßen hätte ein wenig Wasser
nicht geschadet, die Beine waren auch nicht frisch und
appetitlich zu nennen, Arschbacken und Bauch
schrien nach einem Sitzbad zumindest, die Brust
sah abstoßend aus, der Hals war wirklich dreckig, und in den Ohren hätte
man mit bester Aussicht auf baldiges Keimen etwas einsäen können.
ianist Das
zweite Gemälde in Erskines Zimmer zeigt einen Herrn in voller Größe am Piano
sitzend, im Profil von rechts hinten, nackt bis auf den mit Notenpapier bedeckten
Schoß. Mit der rechten Hand hält er einen Akkord, der von Watt mühelos als der
C-Dur-Grundakkord in seiner zweiten Umkehrung erkannt wurde, während er
mit der anderen die Muschel seines linken Ohrs vergrößert.
Sein rechter Fuß, dem der linke von oben Nachdruck verleiht, tritt mit aller
Macht auf das Forte-Pedal. Den kräftigen Muskeln von Nacken,
Arm, Rumpf, Bauch, Lende, Oberschenkel
und Wade, die wie angestrengte Saiten vorspringen, hatte Mr. O'Connery alle
Fertigkeiten jesuitischen Tastsinns angedeihen lassen. Schweißperlen in so vollendeter
Darstellung, daß sie eines Heem würdig gewesen wären, waren zahlreich über pektorale,
subaxillare und hypogastrische Flächen verteilt. Die rechte Brustwarze,
der ein langes, rotes, einsames Haar entsproß, war im Stadium unverkennbarer
Schwellung, ein reizendes Detail. Der Oberkörper war über die Tastatur
gebeugt, und der Ausdruck des leicht
dem Betrachter zugewandten Gesichts glich dem eines Mannes, der drauf
und dran war, sich nach vielen Tagen eines besonders harten Stuhls zu entledigen,
seine Stirn war nämlich zerfurcht, die Augen waren zugekniffen,
die Nasenlöcher geweitet, der Mund stand halb offen, und der Unterkiefer
hing herab als eine nicht schöner vorstellbare Synthese aus Angst,
Konzentration, Anstrengung, Erregung
und Selbstaufopferung, als eine Illustration der auf ein musikalisches Wesen
ausgeübten außerordentlichen Wirkung der leisen Kakophonie
ferner, sich in den verklingenden Akkord einmischender Obertöne. Mr. O'Connerys
Liebe zum bedeutsamen Detail zeigte sich auch in der Malweise der Zehennägel,
die auffallend üppig wucherten und vom Schmutz zu
strotzen schienen. Auch den Füßen hätte ein wenig Wasser
nicht geschadet, die Beine waren auch nicht frisch und
appetitlich zu nennen, Arschbacken und Bauch
schrien nach einem Sitzbad zumindest, die Brust
sah abstoßend aus, der Hals war wirklich dreckig, und in den Ohren hätte
man mit bester Aussicht auf baldiges Keimen etwas einsäen können. -
(wat)
Pianist
(2) ohren im konzert der pianist läßt seine
finger in die flasche rinnen, die ein klavier ist, und die flasche spritzt die
finger als kölnischwasser in die ohrengalerie. die ohren aber haben keine feinen
nasen. daher lassen sie das kölnischwasser in die ohrenständer rinnen, die innen
hohl sind bis zu den plüschpolstern, auf denen sie als tiefe brunnen sitzen,
und gähnen einander in den mund. - Ernst
Jandl, Laut und Luise. Frankfurt am Main 1990 (zuerst 1970)
Pianist
(3, inspirierter)

- N. N.
Pianist
(4)
Paasch hatte das Klavier übernommen. Spielte im Alleingang. Spielte in
die erste, zweite, dritte Morgenstunde, spielte dem Gebäude das Dach ab, die
oberste, die darauf folgende, die über ihnen liegende Etage, legte alle Schichten
frei, ließ Himmel und Regen und Wolken in den Saal, bis die in der MENSA Verbliebenen,
die Examinierten, die Durchgefallenen, die noch-nicht-Examinierten, alle in
den Morgen ragten, Ol-sens Geschäftstüchtigkeit (doppeltbezahlte Planstelle,
Eigenheim, Auto) zerknülltes Papier war; Staruslaus sein Hörspiel schrieb, das
an einem Tag aufgeführt in allen Sprachen zugleich verstanden wurde, Tyrannei
und Willkür, denn dagegen schrieb er, wie Gewürm in die tiefste Erdspalte krochen;
der Sänger und Amerikanist die Aussicht vom Empire State Building (102 Stockwerke)
genoß. Lisa Delauney allen Dingen, nur durch das Auflegen ihrer kleinen Hand
Flügel verlieh; J.W.Stalins Bild an weißer Wand sich in das aus Mais gefügte
Gesicht N.S. Chruschtschows wandelte und viel später dann in das des Heben Gottes;
Arlecq und Einde (oder war es lsabel) Hand in Hand durch das milde Grau der
Straßen gingen, vorbei an erloschenen Schaufenstern, schweigenden Plakaten,
leeren Parkbänken, durch Baumreihen, auf Wiesen zwischen einem Dreieck von Straßen,
indes Paasch sich auf das Dach des Hochhauses emporspielte, die zeitschlagenden
Zyklopen verdrängte, das Klavier an die Stelle der Glocke setzte, in der Leere
des Herzens, welche der Zustand des Weisen ist, sich selbst, Name, Stand, Berufs-
und Familiensinn, in der erhebenden Wirkung der Musik auflösend. - Fritz Rudolf Fries, Der Weg nach Oobliadooh. Leipzig
1993 (zuerst 1975)
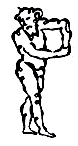 ianist Das
zweite Gemälde in Erskines Zimmer zeigt einen Herrn in voller Größe am Piano
sitzend, im Profil von rechts hinten, nackt bis auf den mit Notenpapier bedeckten
Schoß. Mit der rechten Hand hält er einen Akkord, der von Watt mühelos als der
C-Dur-Grundakkord in seiner zweiten Umkehrung erkannt wurde, während er
mit der anderen die Muschel seines linken Ohrs vergrößert.
Sein rechter Fuß, dem der linke von oben Nachdruck verleiht, tritt mit aller
Macht auf das Forte-Pedal. Den kräftigen Muskeln von Nacken,
Arm, Rumpf, Bauch, Lende, Oberschenkel
und Wade, die wie angestrengte Saiten vorspringen, hatte Mr. O'Connery alle
Fertigkeiten jesuitischen Tastsinns angedeihen lassen. Schweißperlen in so vollendeter
Darstellung, daß sie eines Heem würdig gewesen wären, waren zahlreich über pektorale,
subaxillare und hypogastrische Flächen verteilt. Die rechte Brustwarze,
der ein langes, rotes, einsames Haar entsproß, war im Stadium unverkennbarer
Schwellung, ein reizendes Detail. Der Oberkörper war über die Tastatur
gebeugt, und der Ausdruck des leicht
dem Betrachter zugewandten Gesichts glich dem eines Mannes, der drauf
und dran war, sich nach vielen Tagen eines besonders harten Stuhls zu entledigen,
seine Stirn war nämlich zerfurcht, die Augen waren zugekniffen,
die Nasenlöcher geweitet, der Mund stand halb offen, und der Unterkiefer
hing herab als eine nicht schöner vorstellbare Synthese aus Angst,
Konzentration, Anstrengung, Erregung
und Selbstaufopferung, als eine Illustration der auf ein musikalisches Wesen
ausgeübten außerordentlichen Wirkung der leisen Kakophonie
ferner, sich in den verklingenden Akkord einmischender Obertöne. Mr. O'Connerys
Liebe zum bedeutsamen Detail zeigte sich auch in der Malweise der Zehennägel,
die auffallend üppig wucherten und vom Schmutz zu
strotzen schienen. Auch den Füßen hätte ein wenig Wasser
nicht geschadet, die Beine waren auch nicht frisch und
appetitlich zu nennen, Arschbacken und Bauch
schrien nach einem Sitzbad zumindest, die Brust
sah abstoßend aus, der Hals war wirklich dreckig, und in den Ohren hätte
man mit bester Aussicht auf baldiges Keimen etwas einsäen können.
ianist Das
zweite Gemälde in Erskines Zimmer zeigt einen Herrn in voller Größe am Piano
sitzend, im Profil von rechts hinten, nackt bis auf den mit Notenpapier bedeckten
Schoß. Mit der rechten Hand hält er einen Akkord, der von Watt mühelos als der
C-Dur-Grundakkord in seiner zweiten Umkehrung erkannt wurde, während er
mit der anderen die Muschel seines linken Ohrs vergrößert.
Sein rechter Fuß, dem der linke von oben Nachdruck verleiht, tritt mit aller
Macht auf das Forte-Pedal. Den kräftigen Muskeln von Nacken,
Arm, Rumpf, Bauch, Lende, Oberschenkel
und Wade, die wie angestrengte Saiten vorspringen, hatte Mr. O'Connery alle
Fertigkeiten jesuitischen Tastsinns angedeihen lassen. Schweißperlen in so vollendeter
Darstellung, daß sie eines Heem würdig gewesen wären, waren zahlreich über pektorale,
subaxillare und hypogastrische Flächen verteilt. Die rechte Brustwarze,
der ein langes, rotes, einsames Haar entsproß, war im Stadium unverkennbarer
Schwellung, ein reizendes Detail. Der Oberkörper war über die Tastatur
gebeugt, und der Ausdruck des leicht
dem Betrachter zugewandten Gesichts glich dem eines Mannes, der drauf
und dran war, sich nach vielen Tagen eines besonders harten Stuhls zu entledigen,
seine Stirn war nämlich zerfurcht, die Augen waren zugekniffen,
die Nasenlöcher geweitet, der Mund stand halb offen, und der Unterkiefer
hing herab als eine nicht schöner vorstellbare Synthese aus Angst,
Konzentration, Anstrengung, Erregung
und Selbstaufopferung, als eine Illustration der auf ein musikalisches Wesen
ausgeübten außerordentlichen Wirkung der leisen Kakophonie
ferner, sich in den verklingenden Akkord einmischender Obertöne. Mr. O'Connerys
Liebe zum bedeutsamen Detail zeigte sich auch in der Malweise der Zehennägel,
die auffallend üppig wucherten und vom Schmutz zu
strotzen schienen. Auch den Füßen hätte ein wenig Wasser
nicht geschadet, die Beine waren auch nicht frisch und
appetitlich zu nennen, Arschbacken und Bauch
schrien nach einem Sitzbad zumindest, die Brust
sah abstoßend aus, der Hals war wirklich dreckig, und in den Ohren hätte
man mit bester Aussicht auf baldiges Keimen etwas einsäen können.










