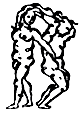 eweglichkeit Hoffmann
war von sehr kleiner Statur, hatte eine gelbliche Gesichtsfarbe, dunkles, beinahe
schwarzes Haar, das ihm tief bis in die Stirn gewachsen war, graue Augen,
die nichts Besonderes auszeichneten, wenn er ruhig vor sich hinblickte; die
aber, wenn er, wie er oft zu tun pflegte, damit blinzelte, einen ungemein listigen
Ausdruck annahmen. Die Nase war fein und gebogen, der
Mund fest geschlossen.
eweglichkeit Hoffmann
war von sehr kleiner Statur, hatte eine gelbliche Gesichtsfarbe, dunkles, beinahe
schwarzes Haar, das ihm tief bis in die Stirn gewachsen war, graue Augen,
die nichts Besonderes auszeichneten, wenn er ruhig vor sich hinblickte; die
aber, wenn er, wie er oft zu tun pflegte, damit blinzelte, einen ungemein listigen
Ausdruck annahmen. Die Nase war fein und gebogen, der
Mund fest geschlossen.

Sein Körper schien, ungeachtet seiner Behendigkeit, dauerhaft, denn er hatte
für seine Größe eine hohe Brust und breite Schultern.
Sein Anzug war in früheren Zeiten seines Lebens ziemlich elegant, ohne irgend
ins Gesuchte zu verfallen. Nur auf den Backenbart hielt er große Stücke und
ließ ihn sorgfältig gegen die Mundwinkel hinziehen. Später erregte ihm seine
Uniform, in welcher er etwa wie ein französischer oder italienischer General
aussah, inniges Wohlgefallen.
In seiner ganzen äußern Erscheinung fiel am meisten eine außerordentliche
Beweglichkeit auf, die auf das Höchste gesteigert wurde, wenn er erzählte. Seine
Begrüßungen beim Empfang und Abschied mit wiederholten ganz kurzen, schnellen
Beugungen des Nackens, ohne daß der Kopf sich dabei bewegte, hatten etwas Fratzenhaftes
und konnten leicht als Ironie erscheinen, wenn der
Eindruck, den die seltsame Gebärde machte, nicht durch sein sehr freundliches
Wesen bei solchen Veranlassungen gemildert worden wäre.
Er sprach mit unglaublicher Schnelle und mit einer etwas heisern Stimme,
so daß er, vorzüglich in den letzten Jahren seines Lebens, wo er einige Vorderzähne
verloren hatte, sehr schwer zu verstehen war. Wenn er erzählte, war es immer
in ganz kurzen Sätzen; nur wenn die Rede auf Kunstsachen kam und er in Begeisterung
geriet, ein Zustand, vor dem er sich aber zu hüten schien, bildete er lange,
schöne, gerundete Perioden. Wenn er Arbeiten von sich vorlas, schriftstellerische
oder amtliche, so eilte er über das Unbedeutendere dergestalt hinweg, daß der
Zuhörer kaum zu folgen vermochte; die Stellen aber, die man im Gemälde die Drucker
nennt, betonte er mit einem fast komischen Pathos, spitzte dazu den Mund, schaute
um sich, ob sie auch faßten, und brachte dadurch oft sich selbst und sein Publikum
aus der Tramontane. Er fühlte, daß er, um dieser Angewohnheit willen, nicht
gut las, und hatte es ungemein gern, wenn ein anderer ihm dies Geschäft abnahm;
aber das war kitzlich genug, besonders wenn von handschriftlichen Aufsätzen
die Rede; denn jedes falsch gelesene Wort oder auch nur ein zögernder Blick
auf ein solches, um es richtig zu lesen, war ihm ein Dolchstich, und er wußte
dies nicht zu verbergen. Als Sänger hatte er eine schöne, kräftige Bruststimme,
Tenor. - E.T.A. Hoffmanns Leben und Nachlass. Von Julius Eduard Hitzig.
Frankfurt am Main 1986 (it 1986, zuerst ca. 1825)
Beweglichkeit (2) Physiologisch merkwürdig ist, daß das
Uebergewicht der Masse des Gehirns über die des Rückenmarks und der Nerven,
welches, nach Sömmerings scharfsinniger Entdeckung, den wahren nächsten
Maaßstab für den Grad der Intelligenz, sowohl in den Thiergeschlechtern, als
in den menschlichen Individuen, abgiebt, zugleich die unmittelbare Beweglichkeit,
die Agilität der Glieder vermehrt; weil, durch die große
Ungleichheit des Verhältnisses, die Abhängigkeit aller motorischen Nerven vom
Gehirn entschiedener wird; wozu wohl noch kommt, daß an der qualitativen Vollkommenheit
des großen Gehirns auch die des kleinen, dieses nächsten
Lenkers der Bewegungen, Theil nimmt; durch Beides also alle willkürlichen Bewegungen
größere Leichtigkeit, Schnelle und Behändigkeit gewinnen, und durch die Koncentration
des Ausgangspunktes aller Aktivität Das entsteht, was Lichtenberg an
Garrick lobt: »daß er allgegenwärtig in den Muskeln seines Körpers schien«.
[Briefe aus England, An Heinrich Christian Boie, Erster Brief.] Daher deutet
Schwerfälligkeit im Gange des Körpers auf Schwerfälligkeit im Gange der Gedanken
und wird, so gut wie Schlaffheit der Gesichtszüge und Stumpfheit des Blicks,
als ein Zeichen von Geistlosigkeit betrachtet, sowohl an Individuen, wie an
Nationen. Ein anderes Symptom des angeregten physiologischen Sachverhältnisses
ist der Umstand, daß viele Leute, sobald ihr Gespräch mit ihrem Begleiter anfängt
einigen Zusammenhang zu gewinnen, sogleich stillstehn müssen; weil nämlich ihr
Gehirn, sobald es ein Paar Gedanken an einander zu
haken hat, nicht mehr so viel Kraft übrig behält, wie erforderlich ist, um durch
die motorischen Nerven die Beine in Bewegung zu erhalten: so knapp ist bei ihnen
Alles zugeschnitten. -
(wv)
Beweglichkeit (3) Daß Tiere
für Argumente zugänglich sind, bewiesen sie schon in jener Zeit, als es in China
noch das K'uei gab, das auf einem einzigen Bein hüpfte. Der Einbeiner erkundigte
sich beim Tausendfüßler, wie er es mit seinen vielen Beinen schafft. »Hast du
noch nie einen Mann spucken sehen? Die Spucke kommt in Tropfen, die Perlen gleichen,
und in Tröpfchen, die einem Nebelschleier ähnlich sind. Am Ende findet sich
alles zusammen, ohne daß man es zu zählen braucht. Setze ich meinen Mechanismus
in Bewegung, habe ich keine Ahnung, wie ich dies bewerkstellige«, führt der
Tausendfüßler aus, der seinerseits von der Schlange
wissen möchte, wie sie ohne Beine zurechtkommt. »Jeder tut es auf seine Weise«,
orakelt die Schlange, die sich beim Wind erkundigt, wie
er ohne Körper vom Nordmeer zum Südmeer gelangt. »Ein ausgestreckter Finger
kann mich aufhalten und desgleichen ein Tritt. Dennoch bin ich fähig, Bäume
zu entwurzeln und Häuser mitzureißen. Aus lauter kleinen Niederlagen besteht
mein Sieg«, antwortet der Wind. - (loe2)
Beweglichkeit (4)

- Michael
Wolgemut (ca. 1500)
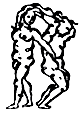 eweglichkeit Hoffmann
war von sehr kleiner Statur, hatte eine gelbliche Gesichtsfarbe, dunkles, beinahe
schwarzes Haar, das ihm tief bis in die Stirn gewachsen war, graue Augen,
die nichts Besonderes auszeichneten, wenn er ruhig vor sich hinblickte; die
aber, wenn er, wie er oft zu tun pflegte, damit blinzelte, einen ungemein listigen
Ausdruck annahmen. Die Nase war fein und gebogen, der
Mund fest geschlossen.
eweglichkeit Hoffmann
war von sehr kleiner Statur, hatte eine gelbliche Gesichtsfarbe, dunkles, beinahe
schwarzes Haar, das ihm tief bis in die Stirn gewachsen war, graue Augen,
die nichts Besonderes auszeichneten, wenn er ruhig vor sich hinblickte; die
aber, wenn er, wie er oft zu tun pflegte, damit blinzelte, einen ungemein listigen
Ausdruck annahmen. Die Nase war fein und gebogen, der
Mund fest geschlossen.












