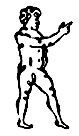 rankheit
Karl Wilhelm Stark raunte in seinen Pathologischen
Fragmenten, Weimar 1824:
rankheit
Karl Wilhelm Stark raunte in seinen Pathologischen
Fragmenten, Weimar 1824:
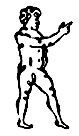 rankheit
Karl Wilhelm Stark raunte in seinen Pathologischen
Fragmenten, Weimar 1824:
rankheit
Karl Wilhelm Stark raunte in seinen Pathologischen
Fragmenten, Weimar 1824:
»Sowohl bei niedern als höhern Organismen sehen wir mehrere selbständige Leben, bald bleibend, bald nur vorübergehend, mit einander vereint ... Ein blühender Obstbaum, wo jeder Ast dem ganzen Gewächs, jeder Zweig wieder dem Ast, jedes Blatt dem Kelche und Blüthenblatt, jedes Einzelne dem Ganzen und wieder dem Einzelnen gleicht, wird gesund genannt. Dem schwangeren Thier, als solchem, dem doppelleibigen ungarischen Mädchen, wird ebenfalls Niemand das nämliche Prädicat verweigern. Wenn aber die Rinde des Baumes mit Moos und Flechten bedeckt ist, die Krone statt der eigenen Blüthen, oder neben denselben die der Eichenmispel zeigt; wenn das Thier in der Gebärmutter statt wirklicher Früchte Windeier, Hyatiden, Fleischmolen, oder in andern Theilen des Körpers Würmer beherbergt, so heißen beide, Pflanze und Thier, krank.«
Stark bestimmte Krankheit
als »eine in einem Individuum sich
entwickelnde, mit dessen Gattungscharakter nicht übereinstimmende
und die individuelle Selbsterhaltung beschränkende Lebensform«,
als »Hinzuerzeugung eines absolut neuen Lebensprozesses zu dem
schon vorhandenen«. - (par)
Krankheit (2) Die Lese-Anfälle waren wieder
und abermals aufgetreten, jetzt zumindestens dem Opfer kenntlich
als Anzeichen einer Sucht. Denn sie wurden verborgen wie eine
strafbare Handlung, Missbrauch einer Lust; Eingreifen der Behörden
dringend geboten. Die Wochenenden schieden aus, da die Voraussetzung
des Alleinseins fehlte. Also wurde der gesamte Nachmittag eines
Wochentages langfristig im Voraus geplant, indem Schularbeiten
vorgezogen oder, wie betrüblich zu erwarten stand, aufgeschoben
wurden, zum Zwecke einer Stunden wahrenden Völlerei an Büchern,
sogar solchen, auf denen der Blick eines Lehrers hätte mit Billigung
ruhen können. Kennzeichnend, dass in fast keinem Fall Tatsachen
auf den Druckseiten vorkamen, sondern erfundene, und dass sie
wieder und abermals angesehen wurden wegen der Fassung, die die
Urheber ihnen gegeben haben. - Uwe Johnson, Begleitumstände.
Frankfurter Vorlesungen. Frankfurt am Main 1980 (es 1019)
Krankheit (3) Anstatt den geheimen Mechanismus
der Ursachen einer Krankheit zu untersuchen, betrachten sie »die Krankheit an
sich«, verurteilen sie als einen schädlichen Ausnahmezustand und empfehlen vorweg
tausend Mittelchen, sie zu unterdrücken, zu beseitigen, und definieren zu diesem
Zweck die Gesundheit als einen absoluten, feststehenden
»Normal«-Zustand. Aber die Krankheiten sind da. Wir
können sie weder nach Belieben schaffen noch abschaffen. Wir sind ihrer nicht
Herr. Sie bilden uns, sie formen uns. Vielleicht haben sie uns gezeugt. Sie
gehören zum Tatbestand »Leben«; sie sind vielleicht sein stärkstes Argument.
Sie sind eine der zahllosen Offenbarungen der Urmaterie. Sie sind vielleicht
die ursprünglichste Offenbarung dieser Materie, die wir ja nur an den Phänomenen
der Relation und der Analogie untersuchen können. Sie sind intermediäres Zwischenglied,
Übergangsstadium, der Gesundheits-Status von morgen. Sie sind vielleicht die
Gesundheit selbst.
- (mora)
Krankheit (4) Krankheit ist vor allem anonym; sie
beraubt ihre Opfer der Persönlichkeit und macht .sie zu Gegenständen. Sie ist
gleichgültig; und es ist die Kälte dieser Gleichgültigkeit - eine metallische
Kälte - die alle, die sie berührt, bis ins Mark ihrer Seele gefrieren läßt.
Sie werden nie mehr Wärme finden. Sie werden niemals mehr glauben, daß sie jemand
sind. - Simone Weil, nach: David B. Morris, Geschichte des Schmerzes. Frankfurt am Main 1996
Krankheit (5) Die meisten Kranckheiten scheinen so individuell zu seyn, wie der Mensch, oder eine Blume oder ein Thier. Krätze, Pocken etc. wird keine Kunst nachahmen können. Viele scheinen mir aber durch die Kunst erregbar zu seyn. Alle wahre Kranckheiten sind erblich - oder epidemisch - oder kürzer organisch - nur durch Erzeugung und Fortpflanzung entstehbar. Daher ist ihre Naturgeschichte, ihre Verwandtschaften (woraus die Complicationen entstehn) ihre Vergleichung so interressant - und wenn man sie auch auf mannichfaltige Art tödten kann, so wird doch nichts wünschenswerther seyn, als ihre gegenseitigen Blutsverwandtschaften und Feindschaften kennen zu lernen, ihre Wohnsitze etc. um sie durch einander selbst zerstören zu lernen.
Viele Kranckheiten sind Irrthümer, die der Mensch erschöpfen muß. -
Novalis, Fragmente und Studien 1799/1800
Krankheit (6) Der Schrift eines Freiherrn von Weizsäcker,
die ich in diesen Tagen las, einer kleinen Oase übrigens, entnehme ich, daß
man heute innerhalb der Medizin die alte Frage nicht mehr als ganz absurd betrachtet,
ob in der Krankheit ein Schuldverhältnis zum Ausdruck
kommt. Unter diesem Gesichtswinkel würde dem Schmerz
die Rolle eines körperlichen Gewissens zufallen
und in seiner künstlichen Betäubung das Ausweichen vor einer Verantwortung zu
erblicken sein. Ohne Zweifel besitzt der Gedanke etwa an eine Geburt, die in
der Narkose geschieht, etwas sehr Beunruhigendes. In meiner persönlichen Erfahrung
verknüpft sich die Erinnerung an eine Schrapnellkugel, die mir, wie ich freilich
gestehen muß, gegen meinen Willen, bei Bewußtsein herausgenommen wurde, mit
dem Gefühl einer Art von Pflichterfüllung; und dergleichen dürfte bei einigem
Nachdenken wohl jeder aufzuweisen haben. - (ej)
Krankheit (7) Die Krankheiten sind
Geschlechter und Arten, lebendige Organismen, die sich im Laufe der Zeit
verändern zugleich mit dem Stamme, an dem sie wuchern und von dem sie
abhängen. Wie es Krankheiten des Kindesalters, des Jünglings-, Mannes-
und Grelsenalters gibt, so auch Krankheiten der Menschheit in ihren
verschiedenen Epochen; so daß, kennte man nur die Geschichte der
Krankheiten besser, sich an ihrem Charakter das Alter des
Menschengeschlechts genau müßte feststellen lassen. Es können deshalb
die Beobachtungen des Hippokrates,
an sich nicht genug zu würdigen, als an anderen Menschen und anderen
Krankheiten gemacht, für unsere Zeit nicht mehr genügen. Allem Anschein
nach tritt das menschliche Geschlecht jetzt in die gefährliche Periode
des Mannesalters; denn unsere Krankheiten unterscheiden sich von den
früheren im allgemeinen durch ihren häufig sensiblen Charakter. Früher
hatte der Organismus mehr Einheit und die Seele mehr Kraft, sowohl die
einzelnen Organe wie die in ihren Organismus hineinspielende Außenwelt
ihrer Alleinherrschaft unterzuordnen; jetzt hingegen ist die Einheit
gelöst, vielleicht am meisten durch die Lustseuche, die Generationen in
ihren Folgen vergiftete. Die Menschen haben die Innigkeit und Kraft der
Triebe, die Einfachheit und Sicherheit des Instinktes verloren und sind
doch noch fern von der Klarheit wissender Vernunft. Je komplizierter,
reicher und bewegter das äußere Leben geworden ist, desto reizbarer die
Seele. Aus der Schwelgerei des Daseins und dem zerstörten
Geschlechtstrieb, aus der maßlos gewordenen Temperatur der bis an die
letzte Faser aufgeregten Seele entspringen Hirnkrankheiten, ja, alle
Krankheiten haben zugleich nervöse Symptome. Wie es nichts Kraftvolles
im Menschen mehr gibt, nicht einmal große Laster, kühnen Egoismus, so
verlieren sich auch die vehementen Krankheiten: alles beginnt mit
Heftigkeit und endet mit Ohnmacht. - Ricarda Huch, Die Romantik. Blütezeit, Ausbreitung und Verfall.
Tübingen 1951, nach Windischmann

 |
||
 |
||
 |
 |
|
 |
||

  |
||
  |
  |
|