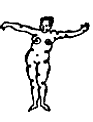 ode,
fremde
Ich dachte unwillkürlich an die überfahrene Katze auf dem neuen
Autobahnabschnitt, an den Toten im Schuppen neben dem Altenheim, der gerade
von einer Schwester gewaschen wurde, als wir uns an einem Vormittag in den Sommerferien
während eines Versteckspiels dort in der Nähe aufhielten, dann an den Eiter,
der aus der Wunde an meinem Knie kam, und natürlich daran, aber davon hatte
ich nur gehört, dass einer aus der Parallelklasse einem anderen mit einem Bleistift
ins Auge gestochen hatte und das Auge aufgeplatzt und zusammen mit dem Kristallkörper
und der darin befindlichen gallertartigen Flüssigkeit auf das Heft getropft
war und auf die Bücher. Besonders schrecklich war das, weil man ein Auge nicht
einfach verbinden und schon gar nicht ersetzen kann. Vergleichbar im Grunde
nur mit dem Stich in die Zunge von Old Shatterhand, als er wochenlang im Zelt
lag und es nicht aufhören wollte zu bluten und er nicht wusste, ob er es überleben
würde und wenn ja, ob er je wieder würde sprechen können. Ich hingegen war nur
gestolpert und mit dem Knie in die herausgebogene Spitze des Abtretrosts vor
der Haustür meiner Großeltern gefallen. Ein anderer Junge, nicht viel älter
als ich, war aufs Klo gegangen und dort tot umgefallen. Ich las seine Todesanzeige
in der Turnerzeitung. In der Todesanzeige stand nicht, wie er genau gestorben
war. Das erfuhr ich von anderen Jungs im Umkleideraum. Dabei ist das doch das
einzig Interessante, wie jemand gestorben ist. Das möchte man wissen, weil es
einem vielleicht später von Nutzen sein kann. Man kann sich dann sagen, jetzt
wird es schwarz, aber danach noch einmal hell, und erst dann stirbt man, so
wie man auch weiß, dass ein Ertrinkender dreimal untergeht und erst wenn er
nach dem dritten Mal an die Wasseroberfläche kommt, wirklich tot ist. Denn vielleicht
erscheinen uns die Toten nur deshalb so unheimlich, weil wir nicht wissen, wie
sie gestorben sind. Vielleicht würden uns die genaueren Kenntnisse über den
Vorgang des Sterbens viel von der Angst nehmen, die wir das gesamte Leben mit
uns herumtragen, ohne uns je von ihr befreien zu können. Und gerade wenn es
dann so weit ist, wenn es einem so geht wie mir im Moment, müsste man nicht
immer jeden Schwindel beobachten und meinen, dass es jetzt schon zu Ende geht,
sondern könnte sich einfach an die vielen anderen Toten und ihre Erfahrungen
erinnern und sich zumindest ein bisschen darauf verlassen. Natürlich ist es
dann doch bei jedem anders, aber in meiner Todesanzeige könnte ruhig stehen,
es war gar nicht so schlimm, wie er es sich vorgestellt hatte, weil er schon
schwach war und oft die Träume nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden
konnte und seine Erinnerungen nicht von der Gegenwart. Unangenehm war eher das
Warten auf den entscheidenden Moment, weil man immer denkt, wie soll ich den
denn schaffen, diesen einen Augenblick, diese Hundertstelsekunde, in der ich
merke: Jetzt, jetzt, jetzt? Was soll ich da denn noch schnell denken? Oder sagen?
Oder fühlen? Deshalb ist die Formulierung: Er war auf der Stelle tot, die bei
besonders schrecklichen Unfällen benutzt wird, auch so wichtig, weil die Lebenden
nicht glauben sollen, es gäbe ein schreckliches Ende, das sich dennoch ewig
hinzieht. Dabei weiß es natürlich niemand genau. Nachdem ich die Todesanzeige
des Jungen aus dem Turnverein gelesen und erfahren hatte, wie er gestorben war,
fürchtete ich mich einige Wochen lang, aufs Klo zu gehen, und wenn ich ging,
so traute ich mich nicht mehr abzuschließen, sondern hielt die linke Hand gegen
die Tür gepresst, damit niemand hereinkommen konnte. Vielleicht hätte mir in
diesem Moment ein noch strukturierterer Tagesablauf geholfen, obwohl ich ja
schon die Schule hatte und den Musizierkreis, die Messdiener- und die Gruppenstunde.
Zwischendurch war ich aber eben immer noch für mich und nicht in einem Sanatorium.
Als ich dann im Sommer schließlich ins Sanatorium kam, da konnte mir das auch
nicht mehr helfen. Selbst die anschließenden Exerzitien konnten mir nicht mehr
helfen, dabei schöpfte ich in dieser Zeit noch einmal Hoffnung auf ein neues
Leben. Deshalb verstehe ich jetzt auch, dass mein Vater zu Recht der Meinung
war, dass es irgendwann einfach zu spät ist mit dem Leben und man selbst nur
noch wenig oder gar nichts mehr dazu tun kann. Man hat das Leben einfach noch
abzuleben, wie eine Murmel ausrollt, wenn sie mit Schwung von einem Sandhügel
kommt. Dabei hatte ich so viel Schreckliches gar nicht gesehen und von den meisten
Dingen ohnehin nur gehört. Am Palmsonntag etwa, als der Scharper nicht mehr
reden konnte, weil ihn sein Vater in der Nacht zuvor mit dem Messer durch die
Straßen gejagt hatte, war ich nicht aufgestellt. Und auch dass der Klassenkamerad
vom Alex gestorben war, weil mit einem Mal aus allen Poren Blut kam, erfuhr
ich erst viel später.
ode,
fremde
Ich dachte unwillkürlich an die überfahrene Katze auf dem neuen
Autobahnabschnitt, an den Toten im Schuppen neben dem Altenheim, der gerade
von einer Schwester gewaschen wurde, als wir uns an einem Vormittag in den Sommerferien
während eines Versteckspiels dort in der Nähe aufhielten, dann an den Eiter,
der aus der Wunde an meinem Knie kam, und natürlich daran, aber davon hatte
ich nur gehört, dass einer aus der Parallelklasse einem anderen mit einem Bleistift
ins Auge gestochen hatte und das Auge aufgeplatzt und zusammen mit dem Kristallkörper
und der darin befindlichen gallertartigen Flüssigkeit auf das Heft getropft
war und auf die Bücher. Besonders schrecklich war das, weil man ein Auge nicht
einfach verbinden und schon gar nicht ersetzen kann. Vergleichbar im Grunde
nur mit dem Stich in die Zunge von Old Shatterhand, als er wochenlang im Zelt
lag und es nicht aufhören wollte zu bluten und er nicht wusste, ob er es überleben
würde und wenn ja, ob er je wieder würde sprechen können. Ich hingegen war nur
gestolpert und mit dem Knie in die herausgebogene Spitze des Abtretrosts vor
der Haustür meiner Großeltern gefallen. Ein anderer Junge, nicht viel älter
als ich, war aufs Klo gegangen und dort tot umgefallen. Ich las seine Todesanzeige
in der Turnerzeitung. In der Todesanzeige stand nicht, wie er genau gestorben
war. Das erfuhr ich von anderen Jungs im Umkleideraum. Dabei ist das doch das
einzig Interessante, wie jemand gestorben ist. Das möchte man wissen, weil es
einem vielleicht später von Nutzen sein kann. Man kann sich dann sagen, jetzt
wird es schwarz, aber danach noch einmal hell, und erst dann stirbt man, so
wie man auch weiß, dass ein Ertrinkender dreimal untergeht und erst wenn er
nach dem dritten Mal an die Wasseroberfläche kommt, wirklich tot ist. Denn vielleicht
erscheinen uns die Toten nur deshalb so unheimlich, weil wir nicht wissen, wie
sie gestorben sind. Vielleicht würden uns die genaueren Kenntnisse über den
Vorgang des Sterbens viel von der Angst nehmen, die wir das gesamte Leben mit
uns herumtragen, ohne uns je von ihr befreien zu können. Und gerade wenn es
dann so weit ist, wenn es einem so geht wie mir im Moment, müsste man nicht
immer jeden Schwindel beobachten und meinen, dass es jetzt schon zu Ende geht,
sondern könnte sich einfach an die vielen anderen Toten und ihre Erfahrungen
erinnern und sich zumindest ein bisschen darauf verlassen. Natürlich ist es
dann doch bei jedem anders, aber in meiner Todesanzeige könnte ruhig stehen,
es war gar nicht so schlimm, wie er es sich vorgestellt hatte, weil er schon
schwach war und oft die Träume nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden
konnte und seine Erinnerungen nicht von der Gegenwart. Unangenehm war eher das
Warten auf den entscheidenden Moment, weil man immer denkt, wie soll ich den
denn schaffen, diesen einen Augenblick, diese Hundertstelsekunde, in der ich
merke: Jetzt, jetzt, jetzt? Was soll ich da denn noch schnell denken? Oder sagen?
Oder fühlen? Deshalb ist die Formulierung: Er war auf der Stelle tot, die bei
besonders schrecklichen Unfällen benutzt wird, auch so wichtig, weil die Lebenden
nicht glauben sollen, es gäbe ein schreckliches Ende, das sich dennoch ewig
hinzieht. Dabei weiß es natürlich niemand genau. Nachdem ich die Todesanzeige
des Jungen aus dem Turnverein gelesen und erfahren hatte, wie er gestorben war,
fürchtete ich mich einige Wochen lang, aufs Klo zu gehen, und wenn ich ging,
so traute ich mich nicht mehr abzuschließen, sondern hielt die linke Hand gegen
die Tür gepresst, damit niemand hereinkommen konnte. Vielleicht hätte mir in
diesem Moment ein noch strukturierterer Tagesablauf geholfen, obwohl ich ja
schon die Schule hatte und den Musizierkreis, die Messdiener- und die Gruppenstunde.
Zwischendurch war ich aber eben immer noch für mich und nicht in einem Sanatorium.
Als ich dann im Sommer schließlich ins Sanatorium kam, da konnte mir das auch
nicht mehr helfen. Selbst die anschließenden Exerzitien konnten mir nicht mehr
helfen, dabei schöpfte ich in dieser Zeit noch einmal Hoffnung auf ein neues
Leben. Deshalb verstehe ich jetzt auch, dass mein Vater zu Recht der Meinung
war, dass es irgendwann einfach zu spät ist mit dem Leben und man selbst nur
noch wenig oder gar nichts mehr dazu tun kann. Man hat das Leben einfach noch
abzuleben, wie eine Murmel ausrollt, wenn sie mit Schwung von einem Sandhügel
kommt. Dabei hatte ich so viel Schreckliches gar nicht gesehen und von den meisten
Dingen ohnehin nur gehört. Am Palmsonntag etwa, als der Scharper nicht mehr
reden konnte, weil ihn sein Vater in der Nacht zuvor mit dem Messer durch die
Straßen gejagt hatte, war ich nicht aufgestellt. Und auch dass der Klassenkamerad
vom Alex gestorben war, weil mit einem Mal aus allen Poren Blut kam, erfuhr
ich erst viel später. -
(raf)
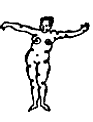 ode,
fremde
Ich dachte unwillkürlich an die überfahrene Katze auf dem neuen
Autobahnabschnitt, an den Toten im Schuppen neben dem Altenheim, der gerade
von einer Schwester gewaschen wurde, als wir uns an einem Vormittag in den Sommerferien
während eines Versteckspiels dort in der Nähe aufhielten, dann an den Eiter,
der aus der Wunde an meinem Knie kam, und natürlich daran, aber davon hatte
ich nur gehört, dass einer aus der Parallelklasse einem anderen mit einem Bleistift
ins Auge gestochen hatte und das Auge aufgeplatzt und zusammen mit dem Kristallkörper
und der darin befindlichen gallertartigen Flüssigkeit auf das Heft getropft
war und auf die Bücher. Besonders schrecklich war das, weil man ein Auge nicht
einfach verbinden und schon gar nicht ersetzen kann. Vergleichbar im Grunde
nur mit dem Stich in die Zunge von Old Shatterhand, als er wochenlang im Zelt
lag und es nicht aufhören wollte zu bluten und er nicht wusste, ob er es überleben
würde und wenn ja, ob er je wieder würde sprechen können. Ich hingegen war nur
gestolpert und mit dem Knie in die herausgebogene Spitze des Abtretrosts vor
der Haustür meiner Großeltern gefallen. Ein anderer Junge, nicht viel älter
als ich, war aufs Klo gegangen und dort tot umgefallen. Ich las seine Todesanzeige
in der Turnerzeitung. In der Todesanzeige stand nicht, wie er genau gestorben
war. Das erfuhr ich von anderen Jungs im Umkleideraum. Dabei ist das doch das
einzig Interessante, wie jemand gestorben ist. Das möchte man wissen, weil es
einem vielleicht später von Nutzen sein kann. Man kann sich dann sagen, jetzt
wird es schwarz, aber danach noch einmal hell, und erst dann stirbt man, so
wie man auch weiß, dass ein Ertrinkender dreimal untergeht und erst wenn er
nach dem dritten Mal an die Wasseroberfläche kommt, wirklich tot ist. Denn vielleicht
erscheinen uns die Toten nur deshalb so unheimlich, weil wir nicht wissen, wie
sie gestorben sind. Vielleicht würden uns die genaueren Kenntnisse über den
Vorgang des Sterbens viel von der Angst nehmen, die wir das gesamte Leben mit
uns herumtragen, ohne uns je von ihr befreien zu können. Und gerade wenn es
dann so weit ist, wenn es einem so geht wie mir im Moment, müsste man nicht
immer jeden Schwindel beobachten und meinen, dass es jetzt schon zu Ende geht,
sondern könnte sich einfach an die vielen anderen Toten und ihre Erfahrungen
erinnern und sich zumindest ein bisschen darauf verlassen. Natürlich ist es
dann doch bei jedem anders, aber in meiner Todesanzeige könnte ruhig stehen,
es war gar nicht so schlimm, wie er es sich vorgestellt hatte, weil er schon
schwach war und oft die Träume nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden
konnte und seine Erinnerungen nicht von der Gegenwart. Unangenehm war eher das
Warten auf den entscheidenden Moment, weil man immer denkt, wie soll ich den
denn schaffen, diesen einen Augenblick, diese Hundertstelsekunde, in der ich
merke: Jetzt, jetzt, jetzt? Was soll ich da denn noch schnell denken? Oder sagen?
Oder fühlen? Deshalb ist die Formulierung: Er war auf der Stelle tot, die bei
besonders schrecklichen Unfällen benutzt wird, auch so wichtig, weil die Lebenden
nicht glauben sollen, es gäbe ein schreckliches Ende, das sich dennoch ewig
hinzieht. Dabei weiß es natürlich niemand genau. Nachdem ich die Todesanzeige
des Jungen aus dem Turnverein gelesen und erfahren hatte, wie er gestorben war,
fürchtete ich mich einige Wochen lang, aufs Klo zu gehen, und wenn ich ging,
so traute ich mich nicht mehr abzuschließen, sondern hielt die linke Hand gegen
die Tür gepresst, damit niemand hereinkommen konnte. Vielleicht hätte mir in
diesem Moment ein noch strukturierterer Tagesablauf geholfen, obwohl ich ja
schon die Schule hatte und den Musizierkreis, die Messdiener- und die Gruppenstunde.
Zwischendurch war ich aber eben immer noch für mich und nicht in einem Sanatorium.
Als ich dann im Sommer schließlich ins Sanatorium kam, da konnte mir das auch
nicht mehr helfen. Selbst die anschließenden Exerzitien konnten mir nicht mehr
helfen, dabei schöpfte ich in dieser Zeit noch einmal Hoffnung auf ein neues
Leben. Deshalb verstehe ich jetzt auch, dass mein Vater zu Recht der Meinung
war, dass es irgendwann einfach zu spät ist mit dem Leben und man selbst nur
noch wenig oder gar nichts mehr dazu tun kann. Man hat das Leben einfach noch
abzuleben, wie eine Murmel ausrollt, wenn sie mit Schwung von einem Sandhügel
kommt. Dabei hatte ich so viel Schreckliches gar nicht gesehen und von den meisten
Dingen ohnehin nur gehört. Am Palmsonntag etwa, als der Scharper nicht mehr
reden konnte, weil ihn sein Vater in der Nacht zuvor mit dem Messer durch die
Straßen gejagt hatte, war ich nicht aufgestellt. Und auch dass der Klassenkamerad
vom Alex gestorben war, weil mit einem Mal aus allen Poren Blut kam, erfuhr
ich erst viel später.
ode,
fremde
Ich dachte unwillkürlich an die überfahrene Katze auf dem neuen
Autobahnabschnitt, an den Toten im Schuppen neben dem Altenheim, der gerade
von einer Schwester gewaschen wurde, als wir uns an einem Vormittag in den Sommerferien
während eines Versteckspiels dort in der Nähe aufhielten, dann an den Eiter,
der aus der Wunde an meinem Knie kam, und natürlich daran, aber davon hatte
ich nur gehört, dass einer aus der Parallelklasse einem anderen mit einem Bleistift
ins Auge gestochen hatte und das Auge aufgeplatzt und zusammen mit dem Kristallkörper
und der darin befindlichen gallertartigen Flüssigkeit auf das Heft getropft
war und auf die Bücher. Besonders schrecklich war das, weil man ein Auge nicht
einfach verbinden und schon gar nicht ersetzen kann. Vergleichbar im Grunde
nur mit dem Stich in die Zunge von Old Shatterhand, als er wochenlang im Zelt
lag und es nicht aufhören wollte zu bluten und er nicht wusste, ob er es überleben
würde und wenn ja, ob er je wieder würde sprechen können. Ich hingegen war nur
gestolpert und mit dem Knie in die herausgebogene Spitze des Abtretrosts vor
der Haustür meiner Großeltern gefallen. Ein anderer Junge, nicht viel älter
als ich, war aufs Klo gegangen und dort tot umgefallen. Ich las seine Todesanzeige
in der Turnerzeitung. In der Todesanzeige stand nicht, wie er genau gestorben
war. Das erfuhr ich von anderen Jungs im Umkleideraum. Dabei ist das doch das
einzig Interessante, wie jemand gestorben ist. Das möchte man wissen, weil es
einem vielleicht später von Nutzen sein kann. Man kann sich dann sagen, jetzt
wird es schwarz, aber danach noch einmal hell, und erst dann stirbt man, so
wie man auch weiß, dass ein Ertrinkender dreimal untergeht und erst wenn er
nach dem dritten Mal an die Wasseroberfläche kommt, wirklich tot ist. Denn vielleicht
erscheinen uns die Toten nur deshalb so unheimlich, weil wir nicht wissen, wie
sie gestorben sind. Vielleicht würden uns die genaueren Kenntnisse über den
Vorgang des Sterbens viel von der Angst nehmen, die wir das gesamte Leben mit
uns herumtragen, ohne uns je von ihr befreien zu können. Und gerade wenn es
dann so weit ist, wenn es einem so geht wie mir im Moment, müsste man nicht
immer jeden Schwindel beobachten und meinen, dass es jetzt schon zu Ende geht,
sondern könnte sich einfach an die vielen anderen Toten und ihre Erfahrungen
erinnern und sich zumindest ein bisschen darauf verlassen. Natürlich ist es
dann doch bei jedem anders, aber in meiner Todesanzeige könnte ruhig stehen,
es war gar nicht so schlimm, wie er es sich vorgestellt hatte, weil er schon
schwach war und oft die Träume nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden
konnte und seine Erinnerungen nicht von der Gegenwart. Unangenehm war eher das
Warten auf den entscheidenden Moment, weil man immer denkt, wie soll ich den
denn schaffen, diesen einen Augenblick, diese Hundertstelsekunde, in der ich
merke: Jetzt, jetzt, jetzt? Was soll ich da denn noch schnell denken? Oder sagen?
Oder fühlen? Deshalb ist die Formulierung: Er war auf der Stelle tot, die bei
besonders schrecklichen Unfällen benutzt wird, auch so wichtig, weil die Lebenden
nicht glauben sollen, es gäbe ein schreckliches Ende, das sich dennoch ewig
hinzieht. Dabei weiß es natürlich niemand genau. Nachdem ich die Todesanzeige
des Jungen aus dem Turnverein gelesen und erfahren hatte, wie er gestorben war,
fürchtete ich mich einige Wochen lang, aufs Klo zu gehen, und wenn ich ging,
so traute ich mich nicht mehr abzuschließen, sondern hielt die linke Hand gegen
die Tür gepresst, damit niemand hereinkommen konnte. Vielleicht hätte mir in
diesem Moment ein noch strukturierterer Tagesablauf geholfen, obwohl ich ja
schon die Schule hatte und den Musizierkreis, die Messdiener- und die Gruppenstunde.
Zwischendurch war ich aber eben immer noch für mich und nicht in einem Sanatorium.
Als ich dann im Sommer schließlich ins Sanatorium kam, da konnte mir das auch
nicht mehr helfen. Selbst die anschließenden Exerzitien konnten mir nicht mehr
helfen, dabei schöpfte ich in dieser Zeit noch einmal Hoffnung auf ein neues
Leben. Deshalb verstehe ich jetzt auch, dass mein Vater zu Recht der Meinung
war, dass es irgendwann einfach zu spät ist mit dem Leben und man selbst nur
noch wenig oder gar nichts mehr dazu tun kann. Man hat das Leben einfach noch
abzuleben, wie eine Murmel ausrollt, wenn sie mit Schwung von einem Sandhügel
kommt. Dabei hatte ich so viel Schreckliches gar nicht gesehen und von den meisten
Dingen ohnehin nur gehört. Am Palmsonntag etwa, als der Scharper nicht mehr
reden konnte, weil ihn sein Vater in der Nacht zuvor mit dem Messer durch die
Straßen gejagt hatte, war ich nicht aufgestellt. Und auch dass der Klassenkamerad
vom Alex gestorben war, weil mit einem Mal aus allen Poren Blut kam, erfuhr
ich erst viel später. 









