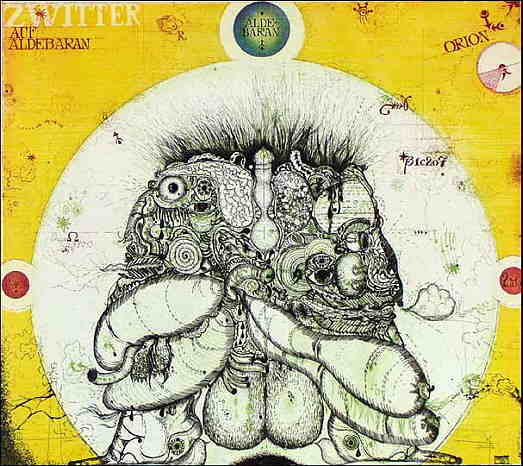
 witter
Zwittrigkeit ist in der Natur nichts Ungewöhnliches. Regenwürmer,
Plattwürmer, manche Schwämme und Schnecken produzieren
sowohl Eier als auch Spermien.
Viele Fische können ihr Geschlecht wechseln und später wieder zurückverwandeln
(Transsexuelle). So sind alle Nassau-Grouper (Epinephelus striatus)
in ihrem Jugendstadium zweigeschlechtlich. Die meisten werden später entweder
Weibchen oder Männchen.
Doch etliche Tiere bleiben auch im erwachsenen Zustand Zwitter.
witter
Zwittrigkeit ist in der Natur nichts Ungewöhnliches. Regenwürmer,
Plattwürmer, manche Schwämme und Schnecken produzieren
sowohl Eier als auch Spermien.
Viele Fische können ihr Geschlecht wechseln und später wieder zurückverwandeln
(Transsexuelle). So sind alle Nassau-Grouper (Epinephelus striatus)
in ihrem Jugendstadium zweigeschlechtlich. Die meisten werden später entweder
Weibchen oder Männchen.
Doch etliche Tiere bleiben auch im erwachsenen Zustand Zwitter.
Sandbarsche der Art Serranus subligarius
können nach der Paarung in Sekundenschnelle ihr Geschlecht wechseln und
sich daraufhin erneut paaren, nur daß das Weibchen jetzt das Männchen ist
und umgekehrt. Es kommt sogar vor, daß ein einsamer
Sandbarsch zunächst seine Eier ablegt und sie anschließend selbst besamt.
- (mier)
Zwitter (2) Tiere und Menschen sind grundsätzlich bisexuell, aber sie tragen ihren eigenen überwiegenden Geschlechtstypus getrennt. Nur bei einer gleichgewichtigen Geschlechtlichkeit erkennen wir das Vereinte.
Man kann nicht die Frage lösen, ob ein Individuum auch nur ein Geschlecht
haben kann. Das mag prinzipiell eine richtige Auffassung sein, aber es
folgt dann daraus, daß Pflanzen und Tiere (oder auch Menschen) niemals
Individuen sind, sondern eng miteinander verschlungene Vielheiten von Individuen,
überwiegend in Synthese. Wenn man sieht, daß beim Mais die weibliche Blüte
sehr tief, die männliche dagegen ganz hoch steht, so erinnert man sich
an Tiere und Menschen, bei denen das weibliche Wesen erheblich kleiner
als das männliche sein kann. Unsichtbar werden diese Synthesen beim einzelnen
Menschen, aber wir würden manches besser begreifen, wenn wir eingesehen
hätten, daß in einem Mann beispielsweise die Frau
klein geblieben ist, das Männliche aber groß,
und daß es hiervon alle nur denkbaren Abweichungen
gibt. - Ernst Fuhrmann, Was die Erde will. Eine Biosophie. München
1986 (Matthes & Seitz, debatte 9, zuerst 1930)
Zwitter (3) Objekte insgesamt acht Fuß lang. Sechs Fuß langer, mit fünf Wülsten ausgestatteter Rumpf, dreieinhalb Fuß zentraler Durchmesser, je ein Fuß Enddurchmesser. Dunkelgrau, flexibel und unendlich zäh. Sieben Fuß lange, membranartige Schwingen von derselben Farbe, in gefaltetem Zustand angetroffen, in den Furchen zwischen den Wülsten angewachsen. Gerüst der Schwingen röhren- oder drüsenartig, von hellerem Grau, mit Öffnungen an Spitzen der Schwingen. Ausgebreitete Schwingen haben gesägten Rand. Entlang zentraler Umfangslinie des Rumpfes, jeweils am zentralen Scheitelpunkt der fünf vertikalen, daubenartigen Wülste, fünf Systeme hellgrauer, flexibler Arme oder Tentakeln, die bei Auffindung fest an den Rumpf gefaltet waren, aber zu einer Maximallänge von über drei Fuß dehnbar sind, Wie die Arme primitiver Haarsterne. Die einzelnen Stengel von drei Zoll Durchmesser verzweigen sich nach sechs Zoll in fünf Einzelstengel, von denen jeder sich nach acht Zoll in kleine, spitz zulaufende Tentakeln oder Ranken gabelt, so daß jeder Arm insgesamt fünfundzwanzig Tentakeln besitzt.
Am oberen Ende des Rumpfes stumpfer, knollenartiger Hals von hellerem Grau, mit kiemenähnlichen Merkmalen, trägt gelblichen, fünfeckigen, seesternförmigen Kopf, der mit drei Zoll langen, drahtigen Wimpern von verschiedenen Prismafarben bedeckt ist.
Kopf groß und aufgebläht, etwa zwei Fuß von Spitze zu Spitze, mit drei Zoll langen, flexiblen, gelblichen Röhren an jeder Spitze. Schlitz genau in der Mitte der Kopfoberseite, offenbar Atmungsöffnung. Am Ende jeder Röhre kugelförmige Ver-dickung, von der gelbliche Membran zurückgeschoben werden kann, so daß glasartige, rot-irisierende Kugel freigelegt wird, offenbar ein Auge.
Fünf etwas längere, rötliche Röhren sind in den Innenwinkeln des seesternförmigen Kopfes angewachsen und laufen in sackartige Schwellungen gleicher Färbung aus, die sich auf Druck bin zu glockenförmigen Öffnungen auftun, mit zwei Zoll MaximaldurchmeSser und ausgekleidet mit scharfen, zahnartigen, weißen Gebilden — wahrscheinlich Münder. All diese Röhren, Wimpern und Spitzen des Seesternkopfes eng gefaltet angetroffen; Röhren und Spitzen lagen dicht an knollenförmigen Hals und Rumpf an. Erstaunliche Flexibilität trotz größter Zähigkeit.
Am unteren Ende des Rumpfes befinden sich ähnlich gebaute, aber anders funktionierende Gegenstücke zu den Kopforganen. Knollenförmiger, hellgrauer Scheinhals, ohne kiemenartige Merkmale, trägt grünliches, fünfeckiges Seesterngebilde.
Zähe, muskulöse Arme vier Fuß lang und spitz zulaufend von sieben Zoll Durchmesser an der Basis zu etwa zweieinhalb an der Spitze. Jede Spitze läuft in ein grünliches, fünfadriges, membranartiges Dreieck aus, das acht Zoll lang und am anderen Ende sechs Zoll breit ist. Das ist das Ruder, die Flosse oder der rudimentäre Fuß, von dem die Abdrücke in den eine Milliarde bis 50 oder 60 Millionen Jahre alten Formationen stammen.
Aus den Innenwinkeln des Seesterngebildes wachsen zwei Fuß lange, rötliche Röhren, die sich von drei Zoll Durchmesser an der Basis auf einen an der Spitze verjüngen. Öffnungen an den Spitzen. All diese Teile unendlich zäh und ledrig, aber sehr flexibel. Vier Fuß lange Arme mit Rudern wurden ohne Zweifel zur Fortbewegung benutzt, im Wasser oder sonstwie. Wenn man sie bewegt, wird ungewöhnliche Muskulosität erkennbar. Bei Auffindung waren all diese Auswüchse eng an den Scheinhals und das Rumpfende gefaltet, entsprechend den Gliedern am anderen Ende.
Ob Pflanze oder Tier, kann noch nicht mit Sicherheit entschieden werden, aber Wahrscheinlichkeit jetzt für Tier. Vermutlich unglaublich hochentwickelte Form von Hohltieren ohne Verlust der primitiven Merkmale. Ähnlichkeit mit Stachelhäutern unverkennbar, trotz einiger gegenteiliger Merkmale.
Schwingen geben Rätsel auf, da wahrscheinlicher
Lebensraum das Meer, aber vielleicht wurden sie zum Schwimmen benutzt.
Die Symmetrie ist merkwürdig pflanzenähnlich und erinnert eher an das Oben
und Unten der pflanzlichen Struktur als an das Vorne und Hinten des tierischen
Körperbaues. Die phantastisch frühe Entwicklungszeit, die weit vor der
Entstehung der primitivsten Protozoen liegen muß, macht jede Vermutung
über den Ursprung unmöglich. - H. P. Lovecraft, Berge des Wahnsinns.
Frankfurt am Main 1979 (st 220, zuerst 1936)
Zwitter (4) Der Neiding übt seinen Seidr stets in weiblicher Kleidung aus; das allein ist für die Germanen schon Grund genug, vom Seidr als verabscheuungswürdigem ergi zu sprechen. Es wird aber sogar angenommen, dass der Neiding durch diese transvestitischen Handlungen sein männliches Geschlecht körperlich verliert, sofern der jeweilige Seidrtreibende ursprünglich männlich ist. Jüngere Dialektformen von Seidr bringen diesen mit den weiblichen Geschlechtsorganen und ihrer Verwendung in Verbindung, und darüberhinaus sind auf den Goldhörnern von Gallehus Seidrtreibende abgebildet, die rituell entmannt werden.
Im Grunde sind daher alle Betreiber des Seidrs entweder weiblichen Geschlechts, oder, im Hinblick auf die Vorstellung vom Neiding, geschlechtslose Unholde, die aber nichtsdestoweniger anständige Krieger durch ansteckendes, weibisches Wesen bedrohen.
Die entsprechenden Authon im Gulathing lauten: „als Mann ein Kind geboren zu haben“, „als Mann eine Hure zu sein“; die Graugans spricht davon, „jede neunte Nacht eine Frau zu sein“, sowie: „als Mann Kinder geboren zu haben“.
- wikipedia
Zwitter (5) Petrus Calanna wagt in einem sonderbaren Buch mit dem Titel Philosophia seniorum sacerdotia & platonica zu sagen, Gott sei männlich & weiblich zugleich. Godofredus Arnoldus vertrat in seinem Buch De Sophia diese monströse Ansicht, die dem Platonismus entsprungen ist, welcher auch die Äonen oder hermaphroditisehe Gottheilen der verschiedenen Valentinians ins Leben gerufen hat. Beausobre (Histoire du Manicheisme, Bd. II) meint, daß diese Äonen allegorisch waren, & er stützt sich darauf, daß der christliche Bischof Synesios Gott zwei Geschlechter beilegte, wiewohl er wußte, daß Gott keine Körperorgane, erst recht keine Zeugungsorgane hat. Bei Synesios liest man aber nur. daß der Körper der Gottheit nicht aus der Hefe der Materie gebildet ist, was nicht heißt, daß Gott kein Körperorgan hat. Außerdem läßt sich leicht nachweisen & Nikephoros Gregoras sagt es in seinem Kommentar zu Synesios an mehreren Stellen, daß Synesios ein Nachahmer & Anhänger Platons war.
Die Manichäer meinten, daß Gott, als er den Menschen schuf, ihn weder als
Mann noch als Frau geformt habe, sondern daß die Trennung der Geschlechter das
Werk des Teufels sei. - Barthez, (enc)
Zwitter (6)
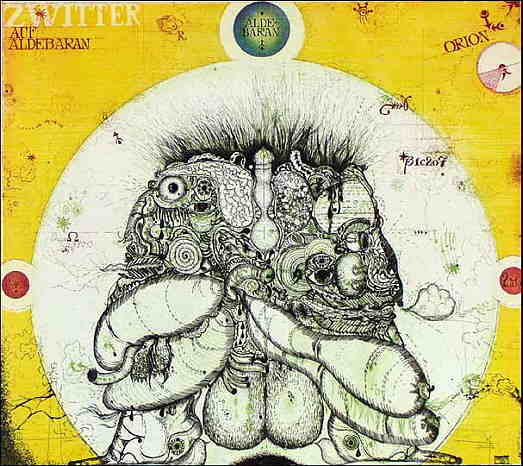
Zwitter (7)
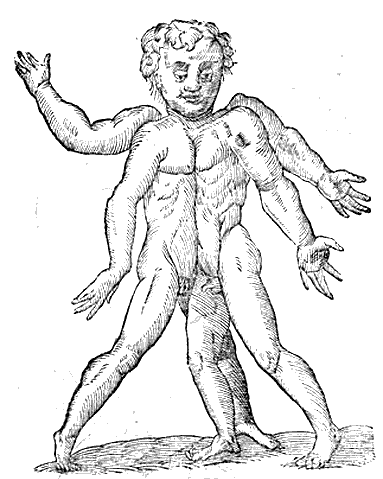
- Ulisse
Aldrovandi, Monstrorum historia (1642)
Zwitter (8)
|
WEISST DU SCHWÄRZT DU Zürich 1922 die zwittrigen leiber sind sie unterscheiden gut ihren vater von ihrer mutter die drittrigen leiber sind |
- Hans Arp, wortträume und schwarze sterne. Wiesbaden 1953
Zwitter (9) Habe einen Nachmittag mit dem Versuch
verbracht, den Zwitter des Aristophanes darzustellen, zu zeichnen: er
ist von rundlichem Aussehen, hat vier Hände, vier Beine, vier Ohren, einen einzigen
Kopf, einen einzigen Hals. Liegen die Hälften Rücken an Rücken oder Gesicht
zu Gesicht? Bauch an Bauch zweifellos, weil Apollo
sie ja da wieder zusammenheften will, indem er die Haut faltet und daraus einen
Nabel macht: ihre Gesichter aber stehen sich gegenüber, weil Apollo sie ja nach
der Seite des Schnittes ziehen muß; und die Geschlechtsorgane sind hinten. Ich
gebe mir große Mühe, aber entweder bin ich ein schlechter Zeichner oder ein
mittelmäßiger Utopist: es will mir durchaus nicht gelingen. Der Zwitter als
Gestalt dieser »ursprünglichen Beschaffenheit [...], und dies Verlangen eben
und Trachten nach dem Ganzen heißt Liebe« - der Zwitter ist für mich nicht darstellbar;
oder wenigstens bringe ich es nur zu einem monströsen, grotesken, unwahrscheinlichen
Körper. Aus dem Traum geht eine farcenhafte Gestalt hervor: so erwächst aus
dem verrückten Paar das Obszöne des Haushalts (der eine besorgt dem anderen
lebenslang die Küche). - (barthes)


 |
||
 |
||
 |
 |
|
 |
||

 |
||
  |
  |
|