







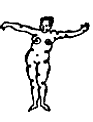 odesart,
klösterliche
Wir sahen der Reihe nach in die Wannen. Sie waren fast alle
leer. Nur die letzte hinter einem zugezogenen Vorhang war voll, und daneben
lag ein zusammengeknülltes Kleidungsstück auf dem Boden. Im ersten Moment erschien
uns die Oberfläche des Wassers ungetrübt. Doch als wir die Lampe näher hinhielten,
entdeckten wir auf dem Grunde der Wanne einen nackten menschlichen Körper. Wir
zogen ihn heraus. Es war Berengar. Und dieser Tote, bemerkte William, sah wirklich
wie ein Ertrunkener aus: das Gesicht aufgedunsen, der weiße und weiche Körper
desgleichen. Er hätte, haarlos wie er war, der Körper einer Frau sein können,
wenn man von dem obszönen Anblick der schlaffen männlichen Scham absah. Ich
errötete, es überlief mich kalt, und ich bekreuzigte mich, während William den
Toten segnete.
odesart,
klösterliche
Wir sahen der Reihe nach in die Wannen. Sie waren fast alle
leer. Nur die letzte hinter einem zugezogenen Vorhang war voll, und daneben
lag ein zusammengeknülltes Kleidungsstück auf dem Boden. Im ersten Moment erschien
uns die Oberfläche des Wassers ungetrübt. Doch als wir die Lampe näher hinhielten,
entdeckten wir auf dem Grunde der Wanne einen nackten menschlichen Körper. Wir
zogen ihn heraus. Es war Berengar. Und dieser Tote, bemerkte William, sah wirklich
wie ein Ertrunkener aus: das Gesicht aufgedunsen, der weiße und weiche Körper
desgleichen. Er hätte, haarlos wie er war, der Körper einer Frau sein können,
wenn man von dem obszönen Anblick der schlaffen männlichen Scham absah. Ich
errötete, es überlief mich kalt, und ich bekreuzigte mich, während William den
Toten segnete. - Umberto Eco, Der Name der Rose. München 1982 (zuerst
1980)
Todesart, klösterliche (2) Der Himmel war klar und wolkenlos, im Osten tagte es, und die weiße Schneedecke ließ das Gelände noch heller erscheinen. Hinter der Kirche, im Hof vor den Ställen, drängten sich Männer um den großen Bottich mit Schweineblut, der seit dem Vortag dort stand. Über den Rand des Bottichs ragte ein seltsam längliches Etwas, x-förmig und schief, als wären es zwei überkreuzte Stangen, wie man sie auf den Feldern in den Boden steckt und mit Lumpen behängt, um die Vögel zu schrecken.
Es waren indes zwei menschliche Beine: die Beine eines kopfüber in den Bottich gestürzten Mannes.
Der Abt befahl, daß man die Leiche (denn nur eine Leiche konnte es sein:
kein Lebender hätte in einer so widernatürlichen Stellung so lange ausgehalten)
aus der eklen Flüssigkeit ziehe. Widerwillig, doch folgsam traten die Schweinehirten
an den Kübelrand und hievten den blutigen Körper heraus, nicht ohne sich selber
dabei aufs heftigste zu besudeln. Das Schweineblut war in der Tat nicht geronnen,
da man es, wie mir am Vortag erklärt worden war, gleich nach der Schlachtung
gründlich gerührt und dann in der Kälte stehengelassen hatte, doch die klebrige
Schicht, die den Leichnam bedeckte, seine Kleidung durchtränkte und seine Züge
unkenntlich machte, wurde nun zusehends stockig und zäh. Ein Diener eilte mit
einem Eimer voll Wasser herbei und goß davon auf das Gesicht des grausigen Toten,
ein anderer beugte sich mit einem Tuch darüber und wusch das Blut ab - und so
erschienen vor unseren Augen allmählich die bleichen Züge des Mönches Venantius
von Salvemec, jenes Kenners der griechischen Welt, den wir am Vortag noch im
Skriptorium bei den Büchern des toten Adelmus gesprochen
hatten. - Umberto Eco, Der Name der Rose. München 1982 (zuerst 1980)
Todesart, klösterliche (3) Durchnäßt vom Schnee, der erst getaut und dann zu Eisklumpen gefroren sei, habe man die Leiche des Unglücklichen am Fuße des Steilhangs gefunden, aufgeschürft von den Felsvorsprüngen, über die er hinabgestürzt. Ein elender und schlimmer Tod, Gott möge sich seiner erbarmen. Wegen der vielen Stöße, die der Körper offensichtlich beim Sturz erlitten, sei es nicht leicht gewesen, den Punkt zu bestimmen, von dem er gefallen sein mußte. Sicher aber aus einem der Fenster, die sich in drei Reihen an drei Seiten des großen Turmes zum Abgrund öffneten.
»Wo habt Ihr den Toten begraben?« fragte William.
»Auf dem Friedhof natürlich«, antwortete der Abt. »Ihr habt ihn vielleicht gesehen, er erstreckt sich neben dem Garten von der Nordseite der Kirche zum Aedificium.«
»Ich verstehe«, sagte William, »und ich begreife nun Euer Problem. Wenn der Ärmste, Gott behüte, Selbstmord begangen hätte (denn es war ja kaum anzunehmen, daß er aus Versehen hinuntergefallen ist), so hättet Ihr am folgenden Morgen eins dieser Fenster offen vorfinden müssen, aber Ihr fandet sie alle wohlverschlossen, und vor keinem von ihnen fanden sich Wasserspuren.«
Wie ich bereits gesagt habe, war der Abt ein Mann von großer Selbstbeherrschung und diplomatischer Unerschütterlichkeit, aber diesmal konnte er seine Überraschung nicht verbergen und schaute so verblüfft drein, daß ihm keine Spur von jener Würde blieb, die sich laut Aristoteles einem ernsthaften und gesetzten Manne ziemt. »Wer hat Euch das gesagt?«
»Nun, Ihr selbst habt es mir gesagt«, erwiderte William. »Wäre ein Fenster offengestanden, so hättet Ihr doch gleich angenommen, daß der Unglückliche sich hinabgestürzt haben mußte. Nach dem, was ich von außen sehen konnte, handelt es sich um große Fenster mit Butzenscheiben, und Fenster dieser Art pflegen sich in Mauern von solcher Stärke gewöhnlich nicht auf ebener Erde zu öffnen. Hättet Ihr also eines von ihnen offen gefunden, so wäre Euch — da auszuschließen war, daß der Unglückliche sich hinausgebeugt und dabei das Gleichgewicht verloren hatte - nur der Gedanke an Selbstmord geblieben.
Und in diesem Falle hättet Ihr ihn nicht in geweihter Erde begraben. Da Ihr
ihn aber christlich begraben habt, müssen die Fenster geschlossen gewesen sein,
und da sie geschlossen waren und mir noch nie, nicht einmal in Hexenprozessen,
ein sündhaft aus dem Leben Geschiedener begegnet ist, dem Gott oder der Teufel
es gestattet hätten, aus der Tiefe wieder heraufzuspringen, um die Spuren seiner
sündigen Tat zu verwischen, liegt es auf der Hand, daß der vermeintliche Selbstmörder
wohl in Wahrheit eher gestoßen worden sein muß, sei's von der Hand eines Menschen
oder von der eines Dämons. Und nun fragt Ihr Euch, wer das gewesen sein mag,
der den armen Bruder Adelmus, ich will nicht sagen hinuntergestürzt, aber doch
mindestens irgendwie seines Willens beraubt und dann, vielleicht in betäubtem
Zustand, auf das Fenstersims gehievt haben könnte, und Ihr seid bestürzt, weil
offenbar eine böse Macht, sei sie natürlich oder übernatürlich, nun in der Abtei
umgeht.« - Umberto Eco, Der Name der Rose. München 1982 (zuerst 1980)
Todesart, klösterliche (4) Einer der Bogenschützen hob die Armillarsphäre auf und reichte sie dem Inquisitor. Das elegante Gebilde aus ineinander verschränkten Kupfer- und Silberkreisen, zusammengehalten durch ein solides Gerüst aus Bronzeringen, war offensichtlich, am Schaft des Ständers gepackt und mit großer Wucht auf den Schädel des Opfers geschlagen worden: An einer Seite waren viele der kleineren Kreise zerbrochen oder zerdrückt, und daß eben diese Seite auf Severins Schädel niedergegangen war, bezeugten grausige Spuren von Blut, verklebt mit Haaren und Klümpchen weißlicher Hirnmasse.
William beugte sich über Severin, um seinen Tod festzustellen. Die Augen
des Ärmsten, blutüberströmt wie der ganze Kopf, waren
weit aufgerissen, und ich fragte mich, ob es wohl möglich wäre, wie es von anderen
Fällen berichtet wurde, in den erstarrten Pupillen des Ermordeten, gleichsam
als Rest seiner letzten Sinneswahmehmung, ein Bild des
Mörders zu erkennen. William untersuchte die Hände
des Toten, wohl um zu sehen, ob an den Fingern schwarze Flecken waren, mochte
in diesem Falle die Todesursache auch ganz offenkundig eine andere sein. Doch
Severin hatte die weichen Lederhandschuhe an, die ich zuweilen an ihm gesehen
hatte, wenn er mit gefährlichen Kräutern, giftigen Echsen oder unbekannten Insekten
hantierte. - Umberto Eco, Der Name der Rose. München 1982 (zuerst 1980)
|
|
||
 |
||
|
|
 |
|
 |
||
|
|
|
|
  |
 
|