










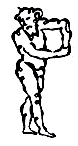 flanze Die
Pflanzen gehören zu den schweigendsten, geheimnisvollsten Erscheinungen
der Welt — sie, auf deren Existenz alles Leben sich stützt, sind gleichsam das
Urbild des Lebens überhaupt. Sie entwachsen unmittelbarer der schöpferischen
Kraft, und so ist es kein Wunder, daß auch das Böse besonders innig in ihre
Säfte übergeht. Viele von ihnen schließen ein Stück paradiesischen
Urwaldes ein. Die Sucht nach dem Rausche ist das Bestreben, sich zeitweilig
dem Bösen zu vermählen, um ihm Kräfte für die Entfaltung, für die größere Ausspannung
und Distanz des geistigen Lebens zu entziehen; und die Pflanze spielt die Rolle
der Vermittlerin. Im Genusse des Apfels, den die Ophiten
verehren, vollzieht sich der erste Sündenfall, der erste Schritt zu einer tieferen
Erkenntnis der Welt; und so ist es nur logisch, daß man in dem für Menschen
von Kultur unbewohnbarsten Lande der Welt, in Nordamerika,
den Genuß des Weines verboten hat und auch den des Tabaks
verbieten möchte. Wo Zufriedenheit und Nützlichkeit regieren, wo Geld die beste
Gabe Gottes ist und wo man es auch vollauf hat, da ist es freilich ein Verbrechen,
die Stimme der Dämonen zu beschwören, die den rechten Weg verwirrt, der durch
die großen Weizenfelder führt. Da spielt ein Mann wie E. A. Poe die Rolle
eines recht üblen Subjekts.
flanze Die
Pflanzen gehören zu den schweigendsten, geheimnisvollsten Erscheinungen
der Welt — sie, auf deren Existenz alles Leben sich stützt, sind gleichsam das
Urbild des Lebens überhaupt. Sie entwachsen unmittelbarer der schöpferischen
Kraft, und so ist es kein Wunder, daß auch das Böse besonders innig in ihre
Säfte übergeht. Viele von ihnen schließen ein Stück paradiesischen
Urwaldes ein. Die Sucht nach dem Rausche ist das Bestreben, sich zeitweilig
dem Bösen zu vermählen, um ihm Kräfte für die Entfaltung, für die größere Ausspannung
und Distanz des geistigen Lebens zu entziehen; und die Pflanze spielt die Rolle
der Vermittlerin. Im Genusse des Apfels, den die Ophiten
verehren, vollzieht sich der erste Sündenfall, der erste Schritt zu einer tieferen
Erkenntnis der Welt; und so ist es nur logisch, daß man in dem für Menschen
von Kultur unbewohnbarsten Lande der Welt, in Nordamerika,
den Genuß des Weines verboten hat und auch den des Tabaks
verbieten möchte. Wo Zufriedenheit und Nützlichkeit regieren, wo Geld die beste
Gabe Gottes ist und wo man es auch vollauf hat, da ist es freilich ein Verbrechen,
die Stimme der Dämonen zu beschwören, die den rechten Weg verwirrt, der durch
die großen Weizenfelder führt. Da spielt ein Mann wie E. A. Poe die Rolle
eines recht üblen Subjekts. - (ej)
Pflanze (2) Wie Pflanzen werden, heißt die Empfehlung.
Fuhrmann weiß sich darin mit asiatischer Lebensweisheit in Übereinstimmung.
Es ist hier aber nicht als Affront gegen das Animalische gesagt, sondern als
Votum für das sublimierte Tier. Man kann die Pflanze nämlich unter dem
Gesichtspunkt betrachten, daß sie Tiere sind, Menschen aber als Mischungen animalischen
und vegetabilen Lebens, auf dem Weg in den Untergang oder zur Engelhaftigkeit.
— »Pflanzen von der Art des Getreides entsprechen in ihrer biologisch-animalischen
Stufe etwa den nacktlebenden Schnecken«. Ein pflanzliches Organ nach dem anderen
mag sich dergestalt auch als ein verkleidetes tierisches zu erkennen geben,
durch Dung-Ernährung ähnlich geworden, wenn dieser
nur auch die wesentlichen Tierqualitäten noch enthielt. Warum sollen Baumstämme
nicht vegetativ gesteigerte Wurmbündel sein; Menschen,
die in Flugzeugen einschlafen, könnten sich als unfähig erwiesen haben, die
Vogelstufe des Lebens in sich hervorzubringen. Die vielen Bettnässer bei Lüneburg
— stehen sie nicht hinter der Heidevegetation zurück, die mit der vielen Feuchtigkeit
in dieser Gegend besser fertig wird? Ist Rotwerden etwa ein Erblühen in kurzer
Heftigkeit? Gehöre ich geschlechtlich zum Typus der Kirsche oder der Brombeere?
— Kein Wunder, daß Bier müde macht: auch Hopfen muß sich
an Stangen halten. - Gert Mattenklott, Nachwort zu: Ernst Fuhrmann, Was
die Erde will - Eine Biosophie. München 1986 (zuerst 1930)
Pflanze (3) IMPATIENS OLIVIERI P DLMS • 100 VII 100 Balsaminee
trop. Ostasiens. Die von Knoten zu Knoten des strotzenden schleimigen Schaftes
Palmetten manschettenartig ansetzende Pflanze endet über saftgrünem Gebäude
in sterilem Schopf, unterhalb dessen an Hängefäden die großen maskenförmigen,
gespornten milchig lila Blumen entspringen, zum Verwechseln ähnlich der Orchidee
Miltonia. — In sd sehr warm, feucht und schattig, nach Aufgang sofort in kleine
Töpfe mit gleicher Mischung, mit Topfballen nach gesicherter Sommerwärme in
Schattenanlagen mit reichem durchlässigen Humus. In Massen, mächtig wirkend.
Vor kalten Nächten in Töpfe mit gleicher Mischung zurückschneiden, halbwarm
überwintern, trocken halten. Jedes Stengelglied, im Warmhaus in hs gesteckt,
bewurzelt sich in 14 Tagen. - (garten)
Pflanze (4) Träumt jemand, daß aus seinem Körper eine
Pflanze gewachsen sei, so wird er, wie einige behaupten, sterben; denn aus der
Erde entstehen die Pflanzen, und in Erde lösen sich die Leiber der Verstorbenen
auf. Nach meiner Auffassung hat man bei der Auslegung nicht allein von den Pflanzen,
sondern auch von den Körperteilen, aus denen die Pflanzen hervorsprießen, auszugehen.
Häufig starb nicht der Träumende selbst, sondern das, was durch den Körperteil,
in dem sich die Pflanze befand, angezeigt wurde. Es besteht auch hinsichtlich
der Pflanzen selbst ein Unterschied, so daß sie zuweilen nicht den Tod, sondern
Schnitte und Eingriffe des Chirurgen zur Folge haben. Das trifft gewöhnlich
bei denjenigen Pflanzen zu, die regelmäßig beschnitten werden, wie z.B. beim
Wein-Stock und ähnlichen. Ich kenne jemand, dem es träumte, ihm sei aus dem
Kopf ein Weinstock hervorgesprossen. Dem Betreffenden wurde nur ein geschwollenes
Zäpfchen aus dem Schlund herausgeschnitten. - (art)
Pflanzen (5) Die Moose lassen sich mit den armseligen Häuslern vergleichen, die sich auf dem magersten Boden niedergelassen haben; diesen decken und nutzen sie, während sie zugleich anderen Pßanzen dienen, indem sie dieselben schirmen, daß ihre Wurzeln nicht unter der Hitze verdorren oder unter der schrecklichen Kälte erfrieren. Sie haben sich gleichsam vorgenommen, den Boden urbar zu machen, der von anderen als untauglich verworfen worden ist. Die Gräser scheinen innerhalb der Pflanzenwelt den Platz der Bauern einzunehmen und deren Pflichten zu erfüllen. Sie besitzen den größten Teil des Bodens und je mehr sie zertreten und unterdrückt werden, desto mehr arbeiten sie, um sich mit ihren Wurzeln ihr Auskommen zu verschaffen; sie machen die Mehrzahl und die Stärke des Pflanzenreiches aus. Die Kräuter hingegen können als der Adel betrachtet werden; sie prunken mit ihren Blättern, prahlen mit ihren überaus herrlichen Blumen und machen mit ihrem Duft, Geschmack, Farben und Formen das Reich, dem sie angehören, bewundert und hoch geschätzt. Die Bäume gleichen den Fürsten. Sie senden ihre Wurzeln weit in die Tiefe und sie tragen ihr Haupt hoch über den anderen Gewächsen. Sie schützen diese vor heftigen Stürmen und vor Vernichtung durch allzu große Wärme und Kälte, sie befeuchten sie gleichsam mit ihrem Tau und versorgen sie in ihrem abgefallenen Laub mit Nahrungsstoffen und bereiten ihnen durch ihre Üppigkeit noch andere Vorteile. An den Moosen und Flechten haben die Baume auch noch Bediente, welche sie mehr zum Prunk als zum eigentlichen Nutzen halten.
Die eigentlichen Bewohner der Erde sind vor allem und namentlich diese Pflanzen.
Jede von ihnen ist mit ihrer besonderen Kraft ausgestattet und führt ihr eigenartiges
Leben. Ob sie die Fähigkeit haben, etwas aufzufassen, wage ich nicht zu sagen.
Hingegen scheint ihnen, was Nahrung und Fortpflanzung anbelangt, eine Art Begehren
inne zu wohnen, sie freuen sich über angenehmes Wetter, gedeihen unter günstigen
Umstanden, erfrischen sich an Regen und Tau, erstarren in der Kälte,
sie halten bei Nacht eine Art Schlaf und nehmen dann eine andere Gestalt an,
sie werden matt vom Hunger. Widerstreben legen sie jedoch durch keinerlei Anzeichen
an den Tag. Daher kommt es, daß man mit Pflanzen kein Mitleid hat. - Carl
von Linné,
nach (lte)
Pflanzen (6) Wenn Sie es verstehen, ihm Zutrauen einzuflößen, führt dieser »Wilde« Sie sogar hinter seine Hütte, in einen versteckten kleinen Hof, wo er seine Pflanzen verborgen hält. Er sucht seinen Hof mehrmals täglich auf — denn er ist mißtrauisch —, um diese Pflanzen zu versorgen, zu pflegen und zu überwachen, die Pflanzen, die er herbeigeholt und weitergezüchtet hat, die geheimnisvollen Pflanzen, deren Heilkräfte und deren schreckliche Wirkungen er allein kennt, die heiligen Pflanzen, die dämonischen Pflanzen, mit denen er einen Kult treibt, die er unter Lebensgefahr dem wilden Urwald entreißen mußte, dem erdrückenden Urwald, der ihn bedrängt — sein einziger, sein hinterhältiger, sein tödlicher, sein ewiger Feind.
Diese Pflanzen sind Lianen, Stauden, Farne, Dornbüsche, Knollenpflanzen, Palmen, Moose, Pilze, giftige und ungiftige Pflanzen, solche, die man mit Blut tränkt oder mit Fleisch füttert, Tages- und Nachtgewächse, von denen manche mittags wie Hunde bellen, während andere im Wind erklingen und wieder andere wie Mimosen nervös werden, wenn das Wetter sich ändert, Pflanzen, die stechen, brennen, kratzen, sich anheften, festkleben, schneiden, bohren, sägen, nachts Düfte ausschicken oder im Mondschein Übelkeit erregen, Pflanzen, die zum Niesen reizen oder einschläfern, Pflanzen, deren Früchte, Blätter, Knospen, Wurzeln, Rinde, Pollen oder Samen zu Giften, Fieberarzneien oder Betäubungsmitteln verarbeitet werden, Pflanzen, aus denen der »Buschmensch« Pulver oder Wein gewinnt, Färbestoffe oder Säfte, Mark oder Harz, Alkohol oder Teer, Gummi oder Kristalle, die er, meist in winzigen Dosen, Elixieren oder Essenzen, Drogen oder Liebestränken, dem Heilung bringenden Mehl oder dem todbringenden Absud beimischt, den er mit Vorbedacht in großen Mengen herstellt.
Unter diesen Pflanzen gibt es eine, die seltenste, die unheimlichste
von allen, die doch in keinem geheimen Garten fehlt, die hinter jeder Eingeborenenhütte
wächst und von der jeder Amazonasbewohner einen kleinen Beutel mit getrockneten
Blättern bei sich trägt, die geheimnisvollste Pflanze des Amazonasgebiets,
denn kein Weißer hat sich je einen Setzling verschaffen können. Die europäischen
Gelehrten, die sie nur vom Hörensagen kennen, haben sie wegen ihrer Wirkung
auf die Psyche vorläufig den gefährlichsten Nervengiften zugeordnet, den
Giften, die, wie sie sagen, »auf die Bewußtseinsschwelle« einwirken, obwohl
jeder Amazonasbewohner sie friedlich in seiner kurzen Pfeife raucht: Es
ist Ibadou, die Pflanze der Schwerelosigkeit.
Mit Hilfe dieser legendären Pflanze kann der »Naturmensch«, ein Gefangener
des Waldes, eine Reise antreten, ohne daß er wie
wir das Schiff oder das Flugzeug nehmen muß ... - Blaise Cendrars, Wahre Geschichten. Zürich 1979
Pflanzen (7) Die Fauna bewegt sich, während die Flora sich vor dem Auge entfaltet.
Eine ganze Gattung von Lebewesen, die der Boden auf sich nimmt. Sie haben ihren gesicherten Platz in der Welt, so wie bei entsprechendem Dienstalter ihren Ehrenschmuck. Im Gegensatz zu ihren vagabundierenden Brüdern sind sie kein Zusatz der Welt, dem Boden nicht beschwerlich. Sie irren nicht umher auf der Suche nach einem Ort, an dem sie sterben, wenn auch die Erde ihre Überreste wie die aller anderen sorgfältig in sich aufnimmt. Für sie gibt's keine Nahrungs- und Wohnungssorgen, kein Einander-Verschlingen: keine Schrecknisse, kein unsinniges Umherlaufen, keine Grausamkeiten, Klagen, Schreie, Worte. Sie sind nicht bloß Gegenstand der Aufregung, des Fiebers und des Todes. Kommen sie zur Welt, haben sie schon ein eigenes Haus, groß oder klein. Um ihre Nachbarn kümmern sie sich nicht im geringsten, auch kriechen sie nicht ineinander, indem sie sich auffressen. Sie gehen nicht durch Schwangerschaft auseinander hervor. Sie sterben durch Austrocknen und Sturz auf den Boden oder vielmehr, indem sie in sich zusammensinken, wo sie gerade stehen, selten verderben sie. Keine Stelle ihres Körpers ist besonders empfindlich, so daß sie, irgendwo durchbohrt, gleich ganz sterben. Aber eine verhältnismäßig größere Reizempfindlichkeit gegenüber Klima und Existenzbedingungen.
Sie sind nicht... Sie sind nicht. . .
Ihre Hölle ist anderer
Art.
Sie haben keine Stimme. Sie sind nahezu gelähmt. Sie vermögen nur mittels ihrer Stellungen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Sie erwecken nicht den Anschein, als litten sie am Gefühl des Nicht-gerechtf ertigt-Seins. Sie könnten einer solchen Plage auch nicht durch die Flucht entrinnen oder durch den Rausch der Geschwindigkeit zu entrinnen vermeinen. Sie kennen keine andere Bewegung, als sich auszudehnen. Keine Gebärde, kein Gedanke, vielleicht auch kein Verlangen, kein Bestreben, das nicht in ein ungeheuerliches Wachstum ihres Körpers einmündete, in einen unheilbaren Auswuchs. Oder vielmehr, und das ist schlimmer, nichts Ungeheuerliches zum Unglück: trotz all ihrer Anstrengungen, »sich auszudrücken«, erreichen sie nur immer wieder eine millionenfache Wiederholung desselben Ausdrucks, desselben Blattes. Im Frühling, wenn sie es müde sind, sich zusammenzunehmen, und nicht mehr an sich halten können, wenn sie ein Gewoge, ein Erbrechen von Grün freilassen und glauben, einen vielfältigen Gesang anzustimmen, außer sich zu geraten, die ganze Natur zu überwuchern, sie zu umarmen, gelingt ihnen doch nur vieltausendmal dieselbe Note, dasselbe Wort, dasselbe Blatt.
Man kann dem Baum nicht mit Baummitteln entgehen.
»Sie drücken sich nur durch ihre Stellungen aus.«
Da ihnen Gebärden
nicht gegeben sind, vervielfachen sie lediglich ihre Arme, ihre Hände,
ihre Finger — wie Buddhas. Dergestalt müßig, denken sie ihre Gedanken bis
zu Ende. Sie sind reiner Ausdruckswille. Nichts in ihnen selbst ist ihnen
verborgen, sie vermögen keinen Gedanken geheimzuhalten, sie entfalten sich
gänzlich, aufrichtig, ohne Vorbehalt.
Da sie müßig sind, vertreiben sie sich die Zeit damit, die eigene Form
zu komplizieren, ihren Körper im Sinne der größtmöglichen analytischen
Komplexität zur Vollendung zu treiben. Wo sie geboren werden, und sei es
noch so sehr im verborgenen, beschäftigen sie sich mit nichts anderem als
mit der Vervollkommnung ihres Ausdrucks: sie treffen ihre Vorbereitungen,
sie schmücken sich, sie warten darauf, daß man
sie liest. - (lyr)
Pflanzen (8)
Pflanzen (9) Überblicken wir einmal im Zusammenhang den ganzen Lebenskreis der Pflanze: wie die Säfte in ihr so regsam quellen, wie es sie drängt, Augen und Zweige zu treiben und rastlos an sich selber zu gestalten, wie sie mit der Krone gen Himmel und mit der Wurzel in die Tiefe trachtet, selbstmächtig, ohne daß sie jemand dorthin zöge oder den Weg ihr dahin wiese; wie sie den Frühling mit jungen Blättern, den Herbst mit reifen Früchten grüßt, einen langen Winter schläft und dann von frischem zu schaffen beginnt, im Trocknen die Blätter hängt und in der Frische sie aufrichtet, sich am Tau erquickt, als Schlingpflanze umherkriecht, die Stütze zu suchen, - wie die Blume erst in der Knospe still verborgen ruht und dann ein Tag kommt, wo sie sich dem Lichte öffnet, wie sie Düfte auszuströmen beginnt und in Wechselverkehr mit Schmetterlingen, Bienen und Käfern tritt, wie das Geschlecht in ihr rege wird, sie morgens sich auftut, des Abends oder vor dem Regen schließt, dem Lichte zuwendet, - und es deucht mich, daß es uns doch schwerfallen sollte, diesen ganzen schwellenden und quellenden, an innerem und äußerem Wechsel so reichen Lebenskreis vergeblich, öde, leer für die Empfindung zu denken.
Freilich sind es nicht Zeichen der Empfindung eines Menschen, einer Katze,
eines Sperlings, eines Fisches, eines Frosches, eines Wurms, was wir hier erblicken;
es sind Zeichen der Empfindung, einer Tanne, einer Weide, einer Lilie, einer
Nelke, eines Mooses. Aber das Seelenleben der Pflanzen soll ja das der Tiere
nicht wiederholen, sondern ergänzen. Und ist nicht doch genug Analogie in jenen
Lebenszeichen sogar mit unseren eigenen, um die Pflanzen noch als unsere Seelenverwandten
anzusehen; wären wir nur nicht so übermäßig stolz auf unsere Beine, mit denen
wir über sie hinlaufen und sie darniedertreten, als reichte es schon hin, Beine
zu haben, um auch einer Seele den Vorrang abzulaufen. Ja, könnten die Pflanzen
laufen und schreien wie wir, niemand spräche ihnen Seele ab; alle jene mannigfaltigen
und zarten und stillen Zeichen von Seele, die sie von sich geben, wiegen uns
nicht so viel als jene groben, die wir an jenen vermissen; und doch sind die
Pflanzen wahrscheinlich bloß stumm für uns, weil wir taub für sie sind. - Gustav Theodor Fechner, Nanna oder Über
das Seelenleben der Pflanzen. In: G. T. F., Das unendliche Leben. München 1984 (zuerst 1848)
Pflanzen (10) Die Pflanze ist ein sehr seltsames Wesen.
Wie alle uns bekannten Naturformen besteht sie aus zwei Hälften, die ein teils entgegengesetztes, teils sich ergänzendes Leben führen. Die eine Hälfte der Pflanze lebt unter Tag im Erdboden. (Von vereinzelten Ausnahmen sprechen wir zunächst nicht. Wenn also eine schmarotzende Pflanze einen Baum oder irgendeinen Pflanzenteil als Wirt benutzt, so ist damit keine Abweichung von unsrem Prinzip vorhanden.)
Der zweite Teil der Pflanze lebt über Tag, im Sonnenlicht.
Der wichtigste Teil der Pflanze ist der Wurzelteil in der Erde. In der Wurzel hat die Pflanze ihre wichtigsten Sinne, denn dort entscheidet sie, welche Nahrung sie aufnehmen will, und damit ist zugleich festgesetzt, was die Pflanze sein wird.
Eine Laubbekleidung hat die Pflanze vergleichsweise sowohl am oberen wie am unteren Körper. An der Wurzel nennen wir dieses Laub: Wurzelhaare. Am oberen Körper bezeichnen wir es als Blätter, Man darf annehmen, daß eigentlich das Laub und die Wurzelhaare zu gleicher Zeit aus Knospungen hervorgehen und zugleich auch absterben, abfallen, unter Hinterlassung von Ersatzknospen.
Eine Pflanze kann man mit einem Tier in vielen Hinsichten vergleichen. Das Tier hat seinen Schwerpunkt im Freßwerkzeug. Durch die in diesem lokalisierten Sinne entscheidet das Tier, was es aufnehmen wird und was nicht. Es hat eine ganz bestimmt gerichtete Appetenz. Viele Tiere sind unerhört einseitig in ihrer Nahrungsaufnahme. Es gibt Tausende von Insektenlarven oder Maden, Raupen usw., die einzig vom Laub einer bestimmten Pflanze leben können und also an ihrem »Nur-so-Sein« mit letzter Energie festhalten. Der Wurzelhaar-Abfall und Laubfall der Pflanze kehrt bei Tieren nicht selten im Wechsel des Haarkleides wieder, teilweise aber reziprok zur Pflanzenzeit.
Betrachtet man die Pflanzen als Tier, so ergibt sich, daß sie stationäre
Tiere sind. Da ihre Nahrungsquelle im Boden selbst ist, muß ihre Bewegung sehr
behindert sein. - Ernst Fuhrmann, Was
die Erde will - Eine Biosophie. München 1986 (zuerst 1930)
Pflanzen (11) Die Pflanzen sind durchaus nichts, als Organe der Erde. Alle Pflanzen sind eines, ein Tier; aber sie sind es durch die Erde, mit der sie es sind. Die Pflanze hat zwei Geschlechter, die beiden andern sind in der Erde. Alle vier machen den Vermählungsakt aus. Indem die Pflanze sich begattet, begattet sich diese Begattung wieder mit der Erde, und alles ist eins. Die Vegetation ist die Erde, die Erde die Sonne; jene das Weib, diese der Mann. Das Tier hat diesen bei sich; es ist gleich der Pflanze, mit einem Stück Boden aus der Erde herausgehoben. Das Gehirn der Pflanze ist die Erde, der Boden. Die Pflanze hat das sensible System in der Erde; diese selbst ist es, jene das irritable.
Die Indifferenz ist irritabel, das Indifferenzierbare, sensibel. Irritation
macht sensibel, Sensation irritabel. Die ewig neue Indifferenz von Irritation
und Sensation ist Leben. - (rit)
Pflanzen (12)
|
Das Schweigen der Pflanzen Die einseitige Bekanntschaft zwischen mir und euch Ich kenne Blatt und Blüte, Ähre, Zapfen, Stengel Wenn meine Neugier auch unerwidert bleibt, Ich nenne euch beim Namen: Wir reisen gemeinsam. An Themen fehlt es nicht, denn uns verbindet vieles. Ich erklär euch, so gut ich kann, fragt nur: Wie aber antworten auf nicht gestellte Fragen, Buschwerk, Haine, Wiesen und Schilf - Mit euch zu reden ist so notwendig wie unmöglich. |
- Wislawa Szymborska, Der Augenblick. Frankfurt am Main 2002

 |
||
 |
||
 |
 |
|
 |
||

|
||
  |
 
|
|