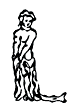 inie
Der Grundgedanke des Ganzen ist der Gedanke der Wandlung. In
den Gesprächen wird einmal erzählt, wie der Meister Kung an einem Fluß
stand und sprach: »So fließt alles dahin wie dieser Fluß, ohne Aufhalten,
Tag und Nacht.« Damit ist der Gedanke der Wandlung
ausgesprochen. Der Blick richtet sich für den, der die Wandlung erkannt
hat, nicht mehr auf die vorüberfließenden Einzeldinge, sondern auf das
unwandelbare ewige Gesetz, das in allem Wandel wirkt. Dieses Gesetz ist
der SINN des Laotse, der Lauf, das Eine in
allem Vielen. Um sich zu verwirklichen, bedarf es einer Entscheidung, einer
Setzung. Diese Grundsetzung ist der große Uranfang
alles dessen, was ist: Tai Gi, eigentlich: der Firstbalken. Die spätere
Philosophie hat sich mit diesem Uranfang viel beschäftigt. Man hat den
Wu Gi, den Ururanfang, als Kreis gezeichnet, und Tai Gi war dann der in
Licht und Dunkel, Yin und Yang, geteilte Kreis, der auch in Indien
und Europa eine Rolle spielte. Aber die Spekulationen gnostisch-dualistischer
Art sind dem Urgedanken des I Ging fremd. Diese Setzung ist für
ihn einfach der Firstbalken, die Linie. Mit dieser Linie, die an sich eins
ist, kommt eine Zweiheit in die Welt. Zugleich mit
ihr ist oben und unten, rechts und links, vorn und hinten - kurz, die Welt
der Gegensätze gesetzt.
inie
Der Grundgedanke des Ganzen ist der Gedanke der Wandlung. In
den Gesprächen wird einmal erzählt, wie der Meister Kung an einem Fluß
stand und sprach: »So fließt alles dahin wie dieser Fluß, ohne Aufhalten,
Tag und Nacht.« Damit ist der Gedanke der Wandlung
ausgesprochen. Der Blick richtet sich für den, der die Wandlung erkannt
hat, nicht mehr auf die vorüberfließenden Einzeldinge, sondern auf das
unwandelbare ewige Gesetz, das in allem Wandel wirkt. Dieses Gesetz ist
der SINN des Laotse, der Lauf, das Eine in
allem Vielen. Um sich zu verwirklichen, bedarf es einer Entscheidung, einer
Setzung. Diese Grundsetzung ist der große Uranfang
alles dessen, was ist: Tai Gi, eigentlich: der Firstbalken. Die spätere
Philosophie hat sich mit diesem Uranfang viel beschäftigt. Man hat den
Wu Gi, den Ururanfang, als Kreis gezeichnet, und Tai Gi war dann der in
Licht und Dunkel, Yin und Yang, geteilte Kreis, der auch in Indien
und Europa eine Rolle spielte. Aber die Spekulationen gnostisch-dualistischer
Art sind dem Urgedanken des I Ging fremd. Diese Setzung ist für
ihn einfach der Firstbalken, die Linie. Mit dieser Linie, die an sich eins
ist, kommt eine Zweiheit in die Welt. Zugleich mit
ihr ist oben und unten, rechts und links, vorn und hinten - kurz, die Welt
der Gegensätze gesetzt. - Richard Wilhelm, Vorwort zu (ig)
Linie (2) Ich stelle über das Zeichnen
nach Gegenständen bisweilen die folgende Betrachtung an: die Formen, die
uns der Gesichtssinn als Umrisse vermittelt, ergeben sich aus der Perzeption
der mit konstanter Sehschärfe von unserem Augenpaar vollzogenen Bewegungen.
Diese verbindende Bewegung ist Linie.
Die Linien sehen heißt: sie nachziehen. Wenn unsere Augen auf mechanischem
Wege einen Zeichenstift zu befehligen vermöchten, so brauchten wir einen
Gegenstand nur zu betrachten, will sagen: mit dem Blick den Grenzen seiner
ungleich gefärbten Zonen zu folgen, um unabhängig von unserm Willen eine
genaue Zeichnung davon zu erhalten. Ebensowohl vermöchten wir den Raum
zwischen zwei Körpern zu zeichnen, der für die Netzhaut mit der gleichen
Deutlichkeit gegeben ist wie ein Gegenstand.
Aber die Hand wird vom Blick
auf sehr indirekte Weise geleitet. Mancherlei Relais treten dazwischen:
unter ihnen das Gedächtnis. Jeder Blick auf
das Vorbild, jede vom Auge nachgezogene Linie wird zum vorübergehenden
Bestandteil einer Erinnerung, und diese Erinnerung
ist es, der die Hand auf dem Papier das Gesetz ihrer Bewegung entlehnt.
Es kommt zur Umformung der visuellen Linienführung in eine manuelle. -
(deg)
Linie (3) Genau auf der Linie zu gehen,
ist gar nicht so leicht. Man kann schwindelig dabei werden. Meistens befindet
man sich wohl auch auf der einen oder der anderen Seite und empfindet es kaum,
wenn man hinüberwechselt; denn es ist nur eine Wasserlinie. Wie gesagt, warum
mir dies gerade am hellen Mittag und auf einer belebten Hauptstraße geschehen
mußte - vielleicht lag es an der erbarmungslosen Klarheit der Februarsonne -,
wüßte ich nicht zu erklären. Ich bemühte mich jedoch, auf der Linie zu bleiben,
weil ich unsicher war, auf welche Seite ich hinübertreten sollte. Das Gefühl
war ungefähr so, als ob man seitlich zu einem Spiegel
stände, und zwar so nah, daß die Fläche des Spiegels mitten durch einen hindurchginge,
so daß man auf der einen Hälfte das wäre, was man zu sein glaubt, während man
auf der anderen Hälfte bereits Bild wäre. Wegen der Schärfe
des Spiegelglases würde dies wahrscheinlich sehr weh tun. - Hans Erich Nossack, Klonz.
In: Ders., Die Erzählungen. Frankfurt am Main 1987 (zuerst 1948)
Linie (4) Die Linie ist wie der Faden,
den Ariadne Theseus gab, bevor er in die mysteriösen Schlupfwinkel des Labyrinths
zurückkehrte. Die Linie führt uns, wenn wir in das Labyrinth der unzähligen
Millionen natürlicher Gegenstände eintreten, die uns umgeben. Ohne eine Linie
wären wir sofort verloren: Niemals wieder würden wir unseren Weg aus dem Irrgarten
herausfinden. Laßt uns der Linie folgen, wohin auch immer sie uns führen mag.
Sie kann uns zu etwas sehr Konkretem und Präzisem hinführen. Aber vielleicht
entführt sie uns auch ins Unterbewußtsein, in das Land der Phantasie. - George Grosz, nach: Peter-Klaus Schuster u.a., George Grosz
Berlin New York. Ausstellungskatalog Berlin 1994
Linie (5) Mendelovitz hat versucht,
die Arten der Linie in eine Systematik zu bringen;
er unterscheidet drei grundsätzliche Typen:
1. Die konstruierte Linie (The Mechanical Line)
Um ein Diagramm, eine
Karte oder einen Plan zu zeichnen, wird man eine möglichst unpersönliche Linie
wünschen, deren Funktion in ihrer Information, nicht in ihrem subjektiven Kommentar
liegt. Mechanisch das Instrument, möglichst glatt das Papier, alles, um die
physische oder psychische Konstitution des Zeichners so wenig als möglich zur
Geltung kommen zu lassen. Dennoch können alle solchen unpersönlichen, kalten
Linien Zeichnungen von großer Schönheit auch im künstlerischen Sinne zustande
bringen. Eine solche wird von den Gewichten der Linien, ihren Beziehungen zueinander
abhängen, den Maßen der freien Räume und dem ganzen Gefüge von Kontrolle, Präzision
und technischer Exaktheit.
2. Die spontane Linie (The Spontaneous Line)
Sie ist der gerade Gegensatz
zur mechanischen Linie und entsteht nicht durch disziplinierte oder präzise
Beobachtung, sondern bezieht ihre Lebhaftigkeit von der Atmosphäre eben aus
der unreflektierten Spontaneität ihrer Improvisation. Das schnelle Hinkritzeln
ist ihr eigentliches Wesen.
3. Die kunstmäßige Linie (The Virtuose Line)
Inbegriff dieser Linienzüge
ist die verfeinerte Verwendung des Pinsels in der ostasiatischen Kunst. Das
Verschmelzen höchster Ausdruckskraft und reinster Ästhetik ist fraglos bewundernswert,
zumal dahinter eine Verwendung der Mittel in hoher Diszipliniertheit steht.
Natürlich, muß man hinzufügen, ist diese Linie auch der Kunst unserer Kultur
nicht fremd, man wird sie zu allen Zeiten und in den verschiedensten Techniken
entdecken können.
Jede Systematik besitzt die Fragwürdigkeit, ob alle Phänomene sich auf solche
Art in verschiedene Schubladen eines Kastens einordnen lassen. Die Wirklichkeit
ist um so vieles reicher und individueller, als es alles Systematisieren überhaupt
ahnen läßt. Aber immerhin ist es nützlich, Unterschiede dadurch besser sehen
zu lernen. Sehen lehren kann man nicht, aber zum Lernen anzuregen - das muß
das Ziel sein.
Die Funktionen der Linien hat Mendelovitz ebenfalls zu kategorisieren versucht:
die Umrißlinie (The Contour Line) ist gewiß eine der wichtigsten, um Gegenstände
und Formen zu charakterisieren, sie kann indes sehr verschieden sein:
a) Der Umriß mit starrer Linie (Contour Lines of Unvarying Width) wurde von
manchen Künstlern des 20. Jahrhunderts seit Picasso verwendet, um eine zwar
elegante und kontrollierte Kunst zu schaffen, ohne aber persönliche Leidenschaften
zur Geltung zu bringen. Ives Tanguy etwa oder Arshile Gorky und manche andere
haben solche Ausdruckselemente gewählt.
b) Der Umriß mit variabler Linie (Contour Line of Varying Width) vermag nicht
weniger elegante Werke zustande zu bringen, die aber doch eine ganz andere Skala
an Ausdrucksmöglichkeiten besitzen, da sich die an- und abschwellende Breite
ganz anders ausdrücken kann.
c) Die darstellende Umrißlinie (The Delineating Edge)
Von der Renaissance an wußte die Zeichenkunst eine im wesentlichen aus der
Kontur bestehende Linie zu nutzen, die dem beobachtenden Auge ebenso gerecht
wird wie der ästhetischen Imagination. Sie wurde das vielleicht essentiellste
Element in der großen Tradition der Meisterzeichnungen, die sich über alle Jahrhunderte
spannt und von einem zum anderen immer weiterschritt. Wenn Ingres von Raffael
ausging, so Degas wiederum von Ingres, um nur ein Beispiel zu nennen.
d) Die fragmentarische Linie (The Fragmented Line)
Das abgeschlossene Zu-Ende-Zeichnen kann einem zu starren Denken entsprechen,
wie etwa Cezannes Grundkonzept erweist, das mit der auf einen Augenpunkt bezogenen
Renaissancetradition gebrochen hat. Durch seinen nach allen Seiten gerichteten
Blick wechseln die Konturen, die Körper gleiten in und aus dem Blickfeld, die
fließende Wahrnehmung ersetzt die optische Fixierung früherer Gewohnheiten.
e) Die kalligraphische Linie (The Calligraphic Line)
Während in allen anderen Linien der Sehakt doch dominiert, ist diese der
Geste des Zeichners allein unterworfen. Demzufolge spielen hier die Materialien
eine besondere Rolle, der gewählte Stift, das Papier usw. Bestimmt wird die
Linie von den verschiedenen Varianten an Breite - also der Kraft -, der Bewegung
von Dünn zu Dick und deren Ausdruck. Man wird ihr vor allem in der Zeichenkunst
Chinas und Japans begegnen.
f) Die lyrische Linie (The Lyric Line)
Manche moderne Künstler haben die lyrischen Impulse in der Linie gesucht,
am meisten wohl die Künstler der »Fauves« -wie etwaRaoul Dufy. Es war ein bezeichnendes
Ziel französischer Kunst in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts,
lyrische Kunst aus der Spontaneität zu erzeugen.
g) Die emphatische Linie (The Emphatic Line)
Die spontan mit Kraft hingesetzte Linie wird etwas von der inneren Leidenschaft
des Künstlers widerspiegeln, wofür van Gogh als Beispiel dienen kann.
h) Die fließende Linie (The Flowing Line)
War es für Matisse die lineare Arabeske mit all ihren emotiven Qualitäten,
so hat Gustav Klimt mit dieser Linie den Kontrast von körperhafter Form und
Ausdruck der Binnenzeichnung zu geben verstanden.
i) Die harte Linie (The Crabbed Line)
Eine scharfe, kritisch charakterisierende Kunst wie die von George Grosz
hat sich auch die entsprechenden linearen Mittel gesucht. Man muß sich nur einmal
eine Zeichnung von Matisse anschauen: »Ein Jubel an Freude«, und dann
eine von Grosz - »den Aufschrei der Qual«. Aber nicht immer muß solche
Linienform der sozialen Anklage dienen, wofür Lyonel Feiningers Zeichnungen
der beste Beweis sind.
k) Die gewundene Linie (The Meandering Line)
Unregelmäßige Bewegungen der Linie erwecken eine besondere Atmosphäre; sie
stellen vielleicht am ehesten ein Äquivalent zu den nervösen Pinselzügen der
Impressionisten dar.
1) Die umschreibende Linie (The Encompassing Line)
Ein Körper vermag durch ein ganzes Gewirr von Linien manchmal nicht nur modellierter
zu werden, sondern auch viel präziser, wenn die Körperform zuerst immer voll
umzeichnet wird, um schließlich erst in den wesentlichen Akzenten betont zu
werden. Aristide Maillol hat solche Blätter geschaffen, doch kannte auch
schon das 17. Jahrhundert die Verwendung solcher Methoden. - Walter Koschatzky, Die Kunst
der Zeichnung. Technik, Geschichte, Meisterwerke. München 1981 (dtv 30741, zuerst
1977)
Linie (6) Die geometrische Linie ist
ein unsichtbares Wesen. Sie ist die Spur des sich bewegenden
Punktes, also sein Erzeugnis. Sie ist aus der Bewegung
entstanden - und zwar durch Vernichtung der höchsten in sich geschlossenen Ruhe
des Punktes. - Wassily Kandinski, nach:
Walter Koschatzky, Die Kunst
der Zeichnung. Technik, Geschichte, Meisterwerke. München 1981 (dtv 30741, zuerst
1977)
Linie (7) »Ich kenne alle hier«, sagte Kerenski,
»aber ich sehe niemand.«
»Sind Sie kurzsichtig, Alexander Fjodorowitsch ?« »Ja, ich bin kurzsichtig.«
»Sie brauchen eine Brille, Alexander Fjodorowitsch.«
»Niemals.«
Da sagte ich mit jugendlichem Feuer: »Bedenken Sie doch, Sie sind ja nicht
nur blind, Sie sind beinahe tot. Die Linie, die göttliche Begrenzung, die Beherrscherin
der Welt, sie ist Ihnen für immer entglitten. Wir beide, wir gehen durch einen
Zaubergarten, den unbeschreibbaren finnischen Wald. Bis zu unserer letzten Stunde
werden wir nichts Schöneres erleben. Die vereisten und rosigen Ränder des Wasserfalls
dort drüben am Fluß können Sie nicht sehen. Die Trauerweide, die sich über den
Wasserfall neigt — Sie sehen ihr japanisches Schnitzwerk nicht. Die roten Stämme
der Kiefern sind mit Schnee bestäubt. Der Schnee glitzert körnig, zuerst, hart
am Stamm, als leblose Linie und an der Oberfläche wellig wie eine Linie Leonardos,
gekrönt vom Widerschein der lodernden Wolken. Und Fräulein Kirstis Seidenstrumpf,
die Linie ihres schon reifen Beines? Kaufen Sie sich eine Brille, Alexander
Fjodorowitsch, ich beschwöre Sie!«
»Kindskopf«, antwortete er, »Sie verschwenden Ihre Zeit. Die fünfzig Kopeken,
die eine Brille kostet, sind genau die fünfzig Kopeken, die ich sparen werde.
Ich brauche Ihre Linie nicht, sie ist so banal wie die Wirklichkeit. Sie leben
nicht besser als ein Trigonometrielehrer, ich aber bin von Wundern umgeben,
sogar an der Kljasma. Was brauche ich die Sommersprossen in Fräulein Kirstis
Gesicht, wenn ich in diesem Mädchen, das ich kaum erkenne, all das ahne, was
ich ahnen will? Was brauche ich die Wolken an diesem finnischen Himmel, wenn
ich einen wogenden Ozean über meinem Haupt erblicke ? Wozu brauche ich die Linie,
wenn ich die Farbe habe ? Die ganze Welt ist für mich ein gigantisches Theater,
in dem ich der einzige Zuschauer ohne Fernglas bin. Das Orchester spielt die
Ouvertüre zum dritten Akt, die Bühne ist mir fern wie im Traum, mir schwillt
das Herz vor Entzücken, ich sehe den Purpursamt an Julia und die violette Seide
an Romeo und nicht einen einzigen falschen Bart . . . und Sie wollen mich mit
einer Brille zu fünfzig Kopeken blind machen.«
Abends fuhr ich in die Stadt. O Helsingfors, du Zuflucht meines Traums!
Alexander Fjodorowitsch sah ich ein halbes Jahr später wieder, im Juni des
Jahres 17, als er Oberbefehlshaber der russischen Armeen und Herr unsres Schicksals
war. - (babel)
Linie (8) Von einem auf dem Tische liegenden
Brief geht eine Linie aus, die läuft über die Tischplatte
aus Fichtenholz und klettert an einem der Beine hinab. Man muß nur gut Obacht
geben und man entdeckt, daß die Linie auf dem Parkettfußboden weiter geht, an
der Mauer emporsteigt, in einen Kupferstich eintritt, der ein Gemälde Bouchers
wiedergibt, den Rücken einer Frau nachzeichnet, die sich auf einem Diwan rekelt,
und sich schließlich aus der Wohnung und über das Dach davon macht und an dem
Blitzableiter auf die Straße herabgleitet. Bei dem Verkehr ist es schwierig,
ihr weiterhin zu folgen, aber wenn man die Augen offen hält, sieht man wohl,
wie sie über das Rad in den Autobus steigt, der an der Ecke hält und zum Hafen
fährt. Dort läuft sie den fleischfarbenen Nylonstrumpf eines wasserstoffblonden
Fahrgastes hinunter, betritt das feindselige Zollgelände, schleicht und kriecht
und schlängelt sich bis an den großen Kai und besteigt hier (aber man sieht
sie nur schwer und weniger gut als die Ratten, die gleich ihr an Bord gehen)
das Schiff mit den singenden Turbinen, läuft über die Planken des Ersterklasse-Decks,
springt mit knapper Not über die große Schiffsluke, und in einer Kabine, in
der ein trauriger Mann Kognak trinkt und den Schiffssirenen lauscht, klettert
sie an der Hosennaht hoch und über die Strickweste, gleitet bis an den Ellbogen
und flüchtet sich mit letzter Kraft in die rechte Hand, die eben Anstalten macht,
sich um den Knauf einer Pistole zu schließen. -
(cron)
Linie (8) Eine Liebesbeziehung mit
einer Linie Koks anzufangen, bringt ausgezeichnete Resultate. Man läßt alle
Hemmungen, die man normalerweise beim ersten Mal hat, fallen. Das Pärchen geht
direkt zur Sache. Beide reden, äußern ihre Wünsche, stellen offen ihre Forderungen.
Und am Ende sind beide der Meinung, daß es sich gelohnt hat. Vor allem wenn
eine Frau so ist wie Maria: spontan, mutig, unverklemmt und erfahren. Eine von
den Frauen, die wie kleine Mädchen lachen können; eine von den Frauen, die ‹ihn›
nicht mit spitzen Fingern anfassen, als hätten sie Ekel davor; eine von den
Frauen, die die Initiative ergreifen und wissen, wie sie es machen müssen. Das
macht dem Mann Lust, die Sache zu wiederholen, bringt ihn dazu, sich selbst
zu übertreffen und immer neue Phantasien auszuleben. Danach ist man erschöpft
und spürt eine unendliche Zärtlichkeit, wenn das Mädchen dann geht. ‹Ich muß
bei Tagesanbruch zu Hause sein, versteh das bitte›. Und man träumt weiter von
Abenteuern mit einem sündigen Schulmädchen, das im Morgengrauen nach Hause geht,
sich in dunklen Eingängen versteckt, heimlich durch den Garten läuft, mühsam
auf das Dach eines Holzschuppens klettert, durch das Fenster in ihr Schlafzimmer
springt und zwischen Puppen mit rosigen Wangen und verschwörerischem Lächeln
einschläft. - Andreu Martin, Aus Liebe zur Kunst. Frankfurt am Main 1994
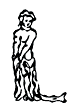 inie
Der Grundgedanke des Ganzen ist der Gedanke der Wandlung. In
den Gesprächen wird einmal erzählt, wie der Meister Kung an einem Fluß
stand und sprach: »So fließt alles dahin wie dieser Fluß, ohne Aufhalten,
Tag und Nacht.« Damit ist der Gedanke der Wandlung
ausgesprochen. Der Blick richtet sich für den, der die Wandlung erkannt
hat, nicht mehr auf die vorüberfließenden Einzeldinge, sondern auf das
unwandelbare ewige Gesetz, das in allem Wandel wirkt. Dieses Gesetz ist
der SINN des Laotse, der Lauf, das Eine in
allem Vielen. Um sich zu verwirklichen, bedarf es einer Entscheidung, einer
Setzung. Diese Grundsetzung ist der große Uranfang
alles dessen, was ist: Tai Gi, eigentlich: der Firstbalken. Die spätere
Philosophie hat sich mit diesem Uranfang viel beschäftigt. Man hat den
Wu Gi, den Ururanfang, als Kreis gezeichnet, und Tai Gi war dann der in
Licht und Dunkel, Yin und Yang, geteilte Kreis, der auch in Indien
und Europa eine Rolle spielte. Aber die Spekulationen gnostisch-dualistischer
Art sind dem Urgedanken des I Ging fremd. Diese Setzung ist für
ihn einfach der Firstbalken, die Linie. Mit dieser Linie, die an sich eins
ist, kommt eine Zweiheit in die Welt. Zugleich mit
ihr ist oben und unten, rechts und links, vorn und hinten - kurz, die Welt
der Gegensätze gesetzt.
inie
Der Grundgedanke des Ganzen ist der Gedanke der Wandlung. In
den Gesprächen wird einmal erzählt, wie der Meister Kung an einem Fluß
stand und sprach: »So fließt alles dahin wie dieser Fluß, ohne Aufhalten,
Tag und Nacht.« Damit ist der Gedanke der Wandlung
ausgesprochen. Der Blick richtet sich für den, der die Wandlung erkannt
hat, nicht mehr auf die vorüberfließenden Einzeldinge, sondern auf das
unwandelbare ewige Gesetz, das in allem Wandel wirkt. Dieses Gesetz ist
der SINN des Laotse, der Lauf, das Eine in
allem Vielen. Um sich zu verwirklichen, bedarf es einer Entscheidung, einer
Setzung. Diese Grundsetzung ist der große Uranfang
alles dessen, was ist: Tai Gi, eigentlich: der Firstbalken. Die spätere
Philosophie hat sich mit diesem Uranfang viel beschäftigt. Man hat den
Wu Gi, den Ururanfang, als Kreis gezeichnet, und Tai Gi war dann der in
Licht und Dunkel, Yin und Yang, geteilte Kreis, der auch in Indien
und Europa eine Rolle spielte. Aber die Spekulationen gnostisch-dualistischer
Art sind dem Urgedanken des I Ging fremd. Diese Setzung ist für
ihn einfach der Firstbalken, die Linie. Mit dieser Linie, die an sich eins
ist, kommt eine Zweiheit in die Welt. Zugleich mit
ihr ist oben und unten, rechts und links, vorn und hinten - kurz, die Welt
der Gegensätze gesetzt. 









