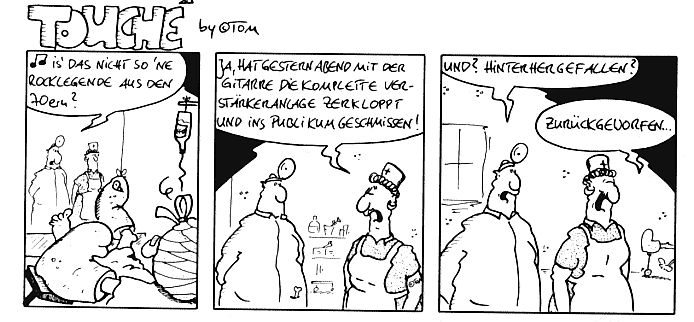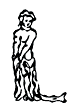 egende
An irgendeiner Stelle seines Werkes versichert Rafael Cansinos Asséns,
er sei imstande, den Sternen in vierzehn klassischen und modernen Sprachen seinen
Gruß zu entbieten. Burton träumte in siebzehn Sprachen und beherrschte,
so wird erzählt, deren fünfunddreißig: semitische, dravidische, indo-europäische,
äthiopische... Dieser Sprachenstrom gibt seine Persönlichkeit aber noch nicht
völlig wieder: er ist nur ein Zug in seinem Porträt und steht mit anderen in
Einklang, die nicht weniger exzessiv sind. Niemand brauchte sich von dem bekannten
Scherzwort im Hudibras gegen die Doktoren, die imstande seien, in verschiedenen
Sprachen rein nichts zu sagen, weniger getroffen zu fühlen als er: Burton
war ein Mann, der überaus viel zu sagen hatte, und die 72 Bände seines Werks
legen immer noch Zeugnis davon ab. Ich zitiere aufs Geratewohl ein paar Titel:
Goa und die Blauen Berge, 1851; Bajonettübungen, systematisch dargestellt,
1853; Persönlicher Bericht von einer Wallfahrt nach Medina, 1855; Die Seengebiete
von Äquatorialafrika, 1860; Die Stadt der Heiligen, 1861; Erforschung der Hochflächen
Brasiliens, 1869; Über einen Hermaphroditen der Kapverdischen Inseln, 1869;
Briefe von den Schlachtfeldern von Paraguay, 1870; Ultima Thule oder ein Sommer
in Island, 1875; An der Goldküste auf Goldsuche, 1883; Das Buch des Schwertes
(erster Band), 1884; Der Duftende Garten von Nafzaua — ein nachgelassenes
Werk, das Lady Burton dem Feuer übergab, ebenso eine Sammlung von Epigrammen
im Geist des Priap. Der Schriftsteller wird in diesem
Verzeichnis faßbar, der engliche Kapitän, der an Erdkunde ebenso leidenschaftlich
interessiert war wie an den unzähligen Arten des Menschseins, die unter den
Menschen bekannt sind. Ich will seinem Gedächtnis nicht zu nahe treten, indem
ich ihn mit Morand vergleiche, dem seßhaften Reiter auf zwei Sprachen,
der ohne Ende in den Fahrstühlen ein und desselben internationalen Hotels hinauf-
und hinunterfährt und ehrfürchtig das Schauspiel eines Koffers genießt... Burton
war als Afghane verkleidet zu den heiligen Städten Arabiens gepilgert; seine
Stimme hatte den Herren angefleht, er möge seine Gebeine und seine Haut, sein
schmerzempfindliches Fleisch und sein Blut vor dem Feuer des Ewigen Zorns und
der Gerechtigkeit verschonen; er hatte mit seinem vom Samum ausgedörrten Mund
auf dem Aerolith, der in der Kaaba verehrt wird, einen Kuß hinterlassen. Dieses
Abenteuer ist berühmt geworden: wäre das Gerücht aufgekommen, ein Unbeschnittener,
ein Mazrani, sei im Begriff das Heiligtum zu entweihen, so wäre sein Tod besiegelt
gewesen. Vorher hatte er im Gewand eines Derwisch in Kairo die Heilkunde
betrieben, nicht ohne zwischendurch Taschenspielerkünste und Zauberei
zu praktizieren, um das Vertrauen seiner Patienten zu gewinnen. Um das Jahr
1858 hatte er eine Expedition zu den verborgenen Quellen des Nil angeführt:
ein Kommando, das ihm die Entdeckung des Tanganjika-Sees eingebracht hatte.
Bei diesem Unternehmen wurde er von hohem Fieber befallen; im Jahr 1855 durchbohrten
ihm die Somalis die Backen mit einer Lanze. (Burton kam von Harrar, der
für Europäer verbotenen Stadt im Inneren Abessiniens.) Neun Jahre später machte
er Bekanntschaft mit der furchtbaren Gastfreundschaft der in strengen Bräuchen
erzogenen Kannibalen des Dahome; als er von dort
zurückkam, fehlte es nicht an Gerüchten (die er vielleicht selber ausstreute,
sicher aber bestärkte), die behaupteten, er hätte von «sonderbarem Fleisch»
gegessen wie der allesverschlingende Prokonsul bei Shakespeare. Die Juden,
die Demokratie, das Auswärtige Amt und das Christentum waren ihm besonders verhaßt;
Lord Byron und den Islam verehrte er. Aus dem
einsamen Geschäft des Schreibens hatte er eine Kraftleistung pluralistischer
Art gemacht: schon früh am Morgen ging er sie an, in einem weiträumigen Salon,
der in elf Tische aufgeteilt war; aufjedem Tisch lag das Material für ein Buch,
und auf einem von ihnen stand ein lichter Jasminzweig in einem Gefäß mit Wasser.
Er entfachte bedeutende Freundschaften und Liebschaften; was die ersten angeht,
sei an die mit Swinburne erinnert, der ihm die zweite Folge von Poems
and Ballads widmete — «in recognition of a friendship which I must always
count among the highest honours of my life» — und der seinen Hingang in
einer Menge Strophen beklagte. Als ein Mann in Worten
und Taten konnte Burton mit vollem Recht den auftrumpfenden Spruch des
Diwan von Almotanabi für sich in Anspruch nehmen:
egende
An irgendeiner Stelle seines Werkes versichert Rafael Cansinos Asséns,
er sei imstande, den Sternen in vierzehn klassischen und modernen Sprachen seinen
Gruß zu entbieten. Burton träumte in siebzehn Sprachen und beherrschte,
so wird erzählt, deren fünfunddreißig: semitische, dravidische, indo-europäische,
äthiopische... Dieser Sprachenstrom gibt seine Persönlichkeit aber noch nicht
völlig wieder: er ist nur ein Zug in seinem Porträt und steht mit anderen in
Einklang, die nicht weniger exzessiv sind. Niemand brauchte sich von dem bekannten
Scherzwort im Hudibras gegen die Doktoren, die imstande seien, in verschiedenen
Sprachen rein nichts zu sagen, weniger getroffen zu fühlen als er: Burton
war ein Mann, der überaus viel zu sagen hatte, und die 72 Bände seines Werks
legen immer noch Zeugnis davon ab. Ich zitiere aufs Geratewohl ein paar Titel:
Goa und die Blauen Berge, 1851; Bajonettübungen, systematisch dargestellt,
1853; Persönlicher Bericht von einer Wallfahrt nach Medina, 1855; Die Seengebiete
von Äquatorialafrika, 1860; Die Stadt der Heiligen, 1861; Erforschung der Hochflächen
Brasiliens, 1869; Über einen Hermaphroditen der Kapverdischen Inseln, 1869;
Briefe von den Schlachtfeldern von Paraguay, 1870; Ultima Thule oder ein Sommer
in Island, 1875; An der Goldküste auf Goldsuche, 1883; Das Buch des Schwertes
(erster Band), 1884; Der Duftende Garten von Nafzaua — ein nachgelassenes
Werk, das Lady Burton dem Feuer übergab, ebenso eine Sammlung von Epigrammen
im Geist des Priap. Der Schriftsteller wird in diesem
Verzeichnis faßbar, der engliche Kapitän, der an Erdkunde ebenso leidenschaftlich
interessiert war wie an den unzähligen Arten des Menschseins, die unter den
Menschen bekannt sind. Ich will seinem Gedächtnis nicht zu nahe treten, indem
ich ihn mit Morand vergleiche, dem seßhaften Reiter auf zwei Sprachen,
der ohne Ende in den Fahrstühlen ein und desselben internationalen Hotels hinauf-
und hinunterfährt und ehrfürchtig das Schauspiel eines Koffers genießt... Burton
war als Afghane verkleidet zu den heiligen Städten Arabiens gepilgert; seine
Stimme hatte den Herren angefleht, er möge seine Gebeine und seine Haut, sein
schmerzempfindliches Fleisch und sein Blut vor dem Feuer des Ewigen Zorns und
der Gerechtigkeit verschonen; er hatte mit seinem vom Samum ausgedörrten Mund
auf dem Aerolith, der in der Kaaba verehrt wird, einen Kuß hinterlassen. Dieses
Abenteuer ist berühmt geworden: wäre das Gerücht aufgekommen, ein Unbeschnittener,
ein Mazrani, sei im Begriff das Heiligtum zu entweihen, so wäre sein Tod besiegelt
gewesen. Vorher hatte er im Gewand eines Derwisch in Kairo die Heilkunde
betrieben, nicht ohne zwischendurch Taschenspielerkünste und Zauberei
zu praktizieren, um das Vertrauen seiner Patienten zu gewinnen. Um das Jahr
1858 hatte er eine Expedition zu den verborgenen Quellen des Nil angeführt:
ein Kommando, das ihm die Entdeckung des Tanganjika-Sees eingebracht hatte.
Bei diesem Unternehmen wurde er von hohem Fieber befallen; im Jahr 1855 durchbohrten
ihm die Somalis die Backen mit einer Lanze. (Burton kam von Harrar, der
für Europäer verbotenen Stadt im Inneren Abessiniens.) Neun Jahre später machte
er Bekanntschaft mit der furchtbaren Gastfreundschaft der in strengen Bräuchen
erzogenen Kannibalen des Dahome; als er von dort
zurückkam, fehlte es nicht an Gerüchten (die er vielleicht selber ausstreute,
sicher aber bestärkte), die behaupteten, er hätte von «sonderbarem Fleisch»
gegessen wie der allesverschlingende Prokonsul bei Shakespeare. Die Juden,
die Demokratie, das Auswärtige Amt und das Christentum waren ihm besonders verhaßt;
Lord Byron und den Islam verehrte er. Aus dem
einsamen Geschäft des Schreibens hatte er eine Kraftleistung pluralistischer
Art gemacht: schon früh am Morgen ging er sie an, in einem weiträumigen Salon,
der in elf Tische aufgeteilt war; aufjedem Tisch lag das Material für ein Buch,
und auf einem von ihnen stand ein lichter Jasminzweig in einem Gefäß mit Wasser.
Er entfachte bedeutende Freundschaften und Liebschaften; was die ersten angeht,
sei an die mit Swinburne erinnert, der ihm die zweite Folge von Poems
and Ballads widmete — «in recognition of a friendship which I must always
count among the highest honours of my life» — und der seinen Hingang in
einer Menge Strophen beklagte. Als ein Mann in Worten
und Taten konnte Burton mit vollem Recht den auftrumpfenden Spruch des
Diwan von Almotanabi für sich in Anspruch nehmen:
Das Roß, die Wüste, die Nacht kennen mich,
Der Gastfreund
und das Schwert, das Papier und die Feder.
Man wird bemerkt haben, daß ich — angefangen mit dem Amateur-Menschenfresser
bis hin zu dem polyglotten Schläfer — auch jene Wesenszüge Richard Burtons
nicht verworfen habe, die wir, ohne in unserer Teilnahme für ihn nachzulassen,
als legendär ansprechen können. - Jorge Luis Borges, Vorwort zu Tausendundeine
Nacht nach Burton (Die Bibliothek von Babel 26, Stuttgart 1984)
Legende (2)
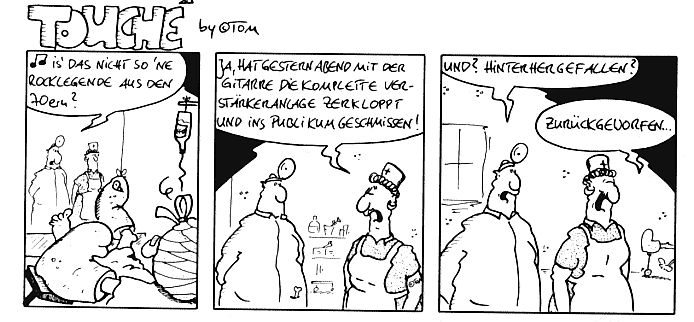
- (tom)
Legende (3) Soweit ich weiß, nahm
er alle gewöhnlichen Rauschmittel - Morphium, Heroin und auch Kokain. Zu welcher
Dosis er sich steigerte, ist schwer zu sagen. Ich habe erlebt, daß drei Gran
Morphium nicht mehr bewirkten, als eine Frau - in einer Geburtsabteilung - normal
ruhigzustellen.
Natürlich hat es ihn schließlich erwischt; er fing in späteren Jahren mächtig
zu schlittern an, machte schlimme Fehler. Aber diese Schlußphase war gekennzeichnet
durch jene seltsame Bewunderung, die manchmal Leute zu einem Mann hinzieht,
gerade weil sein Name so einen gefährlichen Klang hat. Sie lebte wieder auf
in der Art und Weise, wie viele Leute, nicht alle, noch an Rivers hingen, je
tiefer und tiefer es mit ihm bergab ging.
Sie schienen sich sein Bild im Geiste für sich selbst zu schaffen, der geliebte
Sündenbock für ihre eigenen schweifenden Begierden
- und sie glaubten, er allein könnte sie heilen.
Er wurde zu einer Legende und ließ sich immer mehr gehen.
Aber er machte schreckliche Sachen. Es heißt, er hätte die Bemerkung von
sich gegeben, alle Frauen brauchten bloß die Hälfte ihrer Organe - die anderen
wären nur eine Gelegenheit für Chirurgen. Die Hälfte der jungen Frauen von Creston
lebten ohne die Hälfte ihrer Organe, durch seine Dienste, wenn man seinen Reden
glauben kann. - William Carlos Williams, Der
alte Doc Rivers, nach (messer)
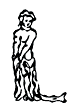 egende
An irgendeiner Stelle seines Werkes versichert Rafael Cansinos Asséns,
er sei imstande, den Sternen in vierzehn klassischen und modernen Sprachen seinen
Gruß zu entbieten. Burton träumte in siebzehn Sprachen und beherrschte,
so wird erzählt, deren fünfunddreißig: semitische, dravidische, indo-europäische,
äthiopische... Dieser Sprachenstrom gibt seine Persönlichkeit aber noch nicht
völlig wieder: er ist nur ein Zug in seinem Porträt und steht mit anderen in
Einklang, die nicht weniger exzessiv sind. Niemand brauchte sich von dem bekannten
Scherzwort im Hudibras gegen die Doktoren, die imstande seien, in verschiedenen
Sprachen rein nichts zu sagen, weniger getroffen zu fühlen als er: Burton
war ein Mann, der überaus viel zu sagen hatte, und die 72 Bände seines Werks
legen immer noch Zeugnis davon ab. Ich zitiere aufs Geratewohl ein paar Titel:
Goa und die Blauen Berge, 1851; Bajonettübungen, systematisch dargestellt,
1853; Persönlicher Bericht von einer Wallfahrt nach Medina, 1855; Die Seengebiete
von Äquatorialafrika, 1860; Die Stadt der Heiligen, 1861; Erforschung der Hochflächen
Brasiliens, 1869; Über einen Hermaphroditen der Kapverdischen Inseln, 1869;
Briefe von den Schlachtfeldern von Paraguay, 1870; Ultima Thule oder ein Sommer
in Island, 1875; An der Goldküste auf Goldsuche, 1883; Das Buch des Schwertes
(erster Band), 1884; Der Duftende Garten von Nafzaua — ein nachgelassenes
Werk, das Lady Burton dem Feuer übergab, ebenso eine Sammlung von Epigrammen
im Geist des Priap. Der Schriftsteller wird in diesem
Verzeichnis faßbar, der engliche Kapitän, der an Erdkunde ebenso leidenschaftlich
interessiert war wie an den unzähligen Arten des Menschseins, die unter den
Menschen bekannt sind. Ich will seinem Gedächtnis nicht zu nahe treten, indem
ich ihn mit Morand vergleiche, dem seßhaften Reiter auf zwei Sprachen,
der ohne Ende in den Fahrstühlen ein und desselben internationalen Hotels hinauf-
und hinunterfährt und ehrfürchtig das Schauspiel eines Koffers genießt... Burton
war als Afghane verkleidet zu den heiligen Städten Arabiens gepilgert; seine
Stimme hatte den Herren angefleht, er möge seine Gebeine und seine Haut, sein
schmerzempfindliches Fleisch und sein Blut vor dem Feuer des Ewigen Zorns und
der Gerechtigkeit verschonen; er hatte mit seinem vom Samum ausgedörrten Mund
auf dem Aerolith, der in der Kaaba verehrt wird, einen Kuß hinterlassen. Dieses
Abenteuer ist berühmt geworden: wäre das Gerücht aufgekommen, ein Unbeschnittener,
ein Mazrani, sei im Begriff das Heiligtum zu entweihen, so wäre sein Tod besiegelt
gewesen. Vorher hatte er im Gewand eines Derwisch in Kairo die Heilkunde
betrieben, nicht ohne zwischendurch Taschenspielerkünste und Zauberei
zu praktizieren, um das Vertrauen seiner Patienten zu gewinnen. Um das Jahr
1858 hatte er eine Expedition zu den verborgenen Quellen des Nil angeführt:
ein Kommando, das ihm die Entdeckung des Tanganjika-Sees eingebracht hatte.
Bei diesem Unternehmen wurde er von hohem Fieber befallen; im Jahr 1855 durchbohrten
ihm die Somalis die Backen mit einer Lanze. (Burton kam von Harrar, der
für Europäer verbotenen Stadt im Inneren Abessiniens.) Neun Jahre später machte
er Bekanntschaft mit der furchtbaren Gastfreundschaft der in strengen Bräuchen
erzogenen Kannibalen des Dahome; als er von dort
zurückkam, fehlte es nicht an Gerüchten (die er vielleicht selber ausstreute,
sicher aber bestärkte), die behaupteten, er hätte von «sonderbarem Fleisch»
gegessen wie der allesverschlingende Prokonsul bei Shakespeare. Die Juden,
die Demokratie, das Auswärtige Amt und das Christentum waren ihm besonders verhaßt;
Lord Byron und den Islam verehrte er. Aus dem
einsamen Geschäft des Schreibens hatte er eine Kraftleistung pluralistischer
Art gemacht: schon früh am Morgen ging er sie an, in einem weiträumigen Salon,
der in elf Tische aufgeteilt war; aufjedem Tisch lag das Material für ein Buch,
und auf einem von ihnen stand ein lichter Jasminzweig in einem Gefäß mit Wasser.
Er entfachte bedeutende Freundschaften und Liebschaften; was die ersten angeht,
sei an die mit Swinburne erinnert, der ihm die zweite Folge von Poems
and Ballads widmete — «in recognition of a friendship which I must always
count among the highest honours of my life» — und der seinen Hingang in
einer Menge Strophen beklagte. Als ein Mann in Worten
und Taten konnte Burton mit vollem Recht den auftrumpfenden Spruch des
Diwan von Almotanabi für sich in Anspruch nehmen:
egende
An irgendeiner Stelle seines Werkes versichert Rafael Cansinos Asséns,
er sei imstande, den Sternen in vierzehn klassischen und modernen Sprachen seinen
Gruß zu entbieten. Burton träumte in siebzehn Sprachen und beherrschte,
so wird erzählt, deren fünfunddreißig: semitische, dravidische, indo-europäische,
äthiopische... Dieser Sprachenstrom gibt seine Persönlichkeit aber noch nicht
völlig wieder: er ist nur ein Zug in seinem Porträt und steht mit anderen in
Einklang, die nicht weniger exzessiv sind. Niemand brauchte sich von dem bekannten
Scherzwort im Hudibras gegen die Doktoren, die imstande seien, in verschiedenen
Sprachen rein nichts zu sagen, weniger getroffen zu fühlen als er: Burton
war ein Mann, der überaus viel zu sagen hatte, und die 72 Bände seines Werks
legen immer noch Zeugnis davon ab. Ich zitiere aufs Geratewohl ein paar Titel:
Goa und die Blauen Berge, 1851; Bajonettübungen, systematisch dargestellt,
1853; Persönlicher Bericht von einer Wallfahrt nach Medina, 1855; Die Seengebiete
von Äquatorialafrika, 1860; Die Stadt der Heiligen, 1861; Erforschung der Hochflächen
Brasiliens, 1869; Über einen Hermaphroditen der Kapverdischen Inseln, 1869;
Briefe von den Schlachtfeldern von Paraguay, 1870; Ultima Thule oder ein Sommer
in Island, 1875; An der Goldküste auf Goldsuche, 1883; Das Buch des Schwertes
(erster Band), 1884; Der Duftende Garten von Nafzaua — ein nachgelassenes
Werk, das Lady Burton dem Feuer übergab, ebenso eine Sammlung von Epigrammen
im Geist des Priap. Der Schriftsteller wird in diesem
Verzeichnis faßbar, der engliche Kapitän, der an Erdkunde ebenso leidenschaftlich
interessiert war wie an den unzähligen Arten des Menschseins, die unter den
Menschen bekannt sind. Ich will seinem Gedächtnis nicht zu nahe treten, indem
ich ihn mit Morand vergleiche, dem seßhaften Reiter auf zwei Sprachen,
der ohne Ende in den Fahrstühlen ein und desselben internationalen Hotels hinauf-
und hinunterfährt und ehrfürchtig das Schauspiel eines Koffers genießt... Burton
war als Afghane verkleidet zu den heiligen Städten Arabiens gepilgert; seine
Stimme hatte den Herren angefleht, er möge seine Gebeine und seine Haut, sein
schmerzempfindliches Fleisch und sein Blut vor dem Feuer des Ewigen Zorns und
der Gerechtigkeit verschonen; er hatte mit seinem vom Samum ausgedörrten Mund
auf dem Aerolith, der in der Kaaba verehrt wird, einen Kuß hinterlassen. Dieses
Abenteuer ist berühmt geworden: wäre das Gerücht aufgekommen, ein Unbeschnittener,
ein Mazrani, sei im Begriff das Heiligtum zu entweihen, so wäre sein Tod besiegelt
gewesen. Vorher hatte er im Gewand eines Derwisch in Kairo die Heilkunde
betrieben, nicht ohne zwischendurch Taschenspielerkünste und Zauberei
zu praktizieren, um das Vertrauen seiner Patienten zu gewinnen. Um das Jahr
1858 hatte er eine Expedition zu den verborgenen Quellen des Nil angeführt:
ein Kommando, das ihm die Entdeckung des Tanganjika-Sees eingebracht hatte.
Bei diesem Unternehmen wurde er von hohem Fieber befallen; im Jahr 1855 durchbohrten
ihm die Somalis die Backen mit einer Lanze. (Burton kam von Harrar, der
für Europäer verbotenen Stadt im Inneren Abessiniens.) Neun Jahre später machte
er Bekanntschaft mit der furchtbaren Gastfreundschaft der in strengen Bräuchen
erzogenen Kannibalen des Dahome; als er von dort
zurückkam, fehlte es nicht an Gerüchten (die er vielleicht selber ausstreute,
sicher aber bestärkte), die behaupteten, er hätte von «sonderbarem Fleisch»
gegessen wie der allesverschlingende Prokonsul bei Shakespeare. Die Juden,
die Demokratie, das Auswärtige Amt und das Christentum waren ihm besonders verhaßt;
Lord Byron und den Islam verehrte er. Aus dem
einsamen Geschäft des Schreibens hatte er eine Kraftleistung pluralistischer
Art gemacht: schon früh am Morgen ging er sie an, in einem weiträumigen Salon,
der in elf Tische aufgeteilt war; aufjedem Tisch lag das Material für ein Buch,
und auf einem von ihnen stand ein lichter Jasminzweig in einem Gefäß mit Wasser.
Er entfachte bedeutende Freundschaften und Liebschaften; was die ersten angeht,
sei an die mit Swinburne erinnert, der ihm die zweite Folge von Poems
and Ballads widmete — «in recognition of a friendship which I must always
count among the highest honours of my life» — und der seinen Hingang in
einer Menge Strophen beklagte. Als ein Mann in Worten
und Taten konnte Burton mit vollem Recht den auftrumpfenden Spruch des
Diwan von Almotanabi für sich in Anspruch nehmen: