
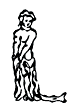 achen,
Schlaf und Hoffnung
gab uns Mutter Natur gegen die Mühseligkeiten eines Lebens, das manche
nicht annähmen, wenn sie zuvor befragt würden. Sagt, was hätten wir armen
Schelme vom Leben, wenn wir unsere Torheiten nicht belachen dürften? Und
hundert Torheiten gäbe es weniger, wenn man sie nicht so ernst
nähme. ...
achen,
Schlaf und Hoffnung
gab uns Mutter Natur gegen die Mühseligkeiten eines Lebens, das manche
nicht annähmen, wenn sie zuvor befragt würden. Sagt, was hätten wir armen
Schelme vom Leben, wenn wir unsere Torheiten nicht belachen dürften? Und
hundert Torheiten gäbe es weniger, wenn man sie nicht so ernst
nähme. ...| Freunde, zankt nicht mit den Toren, Sie haben einen Bund geschworen, Den halten sie und bleiben dumm; Sie würden euren Spott ermüden, Die Herren sind mit sich zufrieden, Das ist ihr Privilegium. Vergebens bleicht man einen Mohren, Vergebens straft man einen Toren, Der Mohr bleibt schwarz, der Tor bleibt dumm Das Bessern ist nicht meine Sache, Ich laß die Toren sein und lache, Das ist mein Privilegium! |
- (kjw)
Lachen (3)

Lachen (3) Das Hebräische kennt zwei
grundverschiedene Wörter für Lachen. Das eine ist sâkhaq, "glückliches
uneingeschränktes Lachen", das andere, lâag bedeutet das "spottende,
herabsetzende Lachen". Das erstere überliefert das Alte Testament
im Buch Genesis 17,18. Jahwe erscheint dem hundertjährigen Abraham und
verkündet ihm, daß er Vater werden wird. Abraham zieht es vor zu schweigen.
Daraufhin sagt Jahwe der neunzig Jahre alten Sarah: "Du wirst Mutter
werden." Sarah krümmt sich vor Lachen. Jetzt ist es Jahwe, der es
vorzieht zu schweigen. Das Unglaubliche geschieht. Ein Knabe wird geboren.
Er erhält den Namen Isaak und dies Wort steht für fröhliches Lachen. -
Aus: Süddeutsche Zeitung 1999 #123 (Esther Knorr-Anders)
Lachen (4) Lachen ist gesund mein Kleines,
totgelacht hat sich noch Keines. - Aus:
Deutsches Poesiealbum,
N. N.
Lachen (5) Das Lachen ist als vulgär
beanstandet worden, weil man dabei den Mund weit öffnet und die Zähne
entblößt. Gewiß enthält das Lachen in seinem Ursprung die Freude an einer
Beute oder Speise, die einem als sicher erscheint. Ein Mensch, der fällt,
erinnert an ein Tier, auf das man aus war und das man selber zu Fall gebracht
hat. Jeder Sturz, der Lachen erregt, erinnert an die Hilflosigkeit des
Gestürzten; man könnte es, wenn man wollte, als Beute behandeln. Man würde
nicht lachen, wenn man in der Reihe der geschilderten Vorgänge weitergehen
und sich's wirklich einverleiben würde. Man lacht, anstatt es zu essen.
Die entgangene Speise ist es, die zum Lachen reizt; das plötzliche Gefühl
der Überlegenheit, wie schon Hobbes gesagt hat ... Es scheint, daß
die Bewegungen, die vom Zwerchfell ausgehen und fürs Lachen charakteristisch
sind, eine Reihe von inneren Schlingbewegungen des Leibes zusammenfassend
ersetzen. - (cane)
Lachen (6) Es wundert mich nicht, daß sie Langeweile haben, wann sie allein sind: sie können nicht allein lachen; sogar erscheint Solches ihnen närrisch. — Ist denn das Lachen etwan nur ein Signal für Andere und ein bloßes Zeichen, wie das Wort? — Mangel an Phantasie und an Lebhaftigkeit des Geistes überhaupt, (dullness [Stumpfsinn]).
Das ist es, was ihnen, wenn allein, das Lachen verwehrt. Die Thiere lachen weder allein, noch in Gesellschaft.
Myson, der Misanthrop, war, allein lachend, von so Einem überrascht
worden, der ihn jetzt fragte, warum er denn lache, da er doch allein wäre?
— »Gerade darum lache ich«, war die Antwort. - (schop)
Lachen (7)
|
Beschwörung durch Lachen Ihr Lacherer, schlagt die Lache an! |
- Velemir Chlebnikov, nach (was)
Lachen (8) ist »diejenige körperliche
Handlung, die sich durch eine stoßweise, gleichsam convulsivische Ausathmung
der Luft, mehrentheils mit gleichartigen Tönen der Stimme und fröhlichen
Gesichtszügen verbunden, zu erkennen gibt, und wodurch eine fröhliche Gemüthsbewegung
angedeutet wird« (Brockhaus 1812). Lachen ist gesund,
behauptet deutlich knapper der Volksmund. Doch während heutige Wissenschaftler
nach immunologischen, hormonellen oder neurologischen Beweisen für diese
Annahme suchen, scheint die Erklärung viel einfacher:
»Durch eine angenehme
Bewegung, die die Einbildungskraft hervorbringt, wird durch die Zusammenkunft
der Nerven das Zwergfell zugleich mit dem Herzen in die Höhe gehoben und
gleichsam zu wiederholtem Aufhüpfen gereizt.« Hier hüpft das Herz vor Freude
und »diese Bewegung theilt sich in so fern auch der Lunge mit, als dadurch
das Blut aus dem Herzen häufiger nach der Lunge getrieben wird«.
Doch damit nicht genug, schließlich hing im Brockhaus 1812 noch alles mit allem zusammen, «wegen des Zusammenhanges der Nerven des Diaphragmas mit den Gesichtsnerven, die Uebereinstimmung des Mundes, der Stimme, des Angesichts und der Gebärden, mit dem Lachen der Ernst«. Brockhaus geht 1892 auf die protektiven Aspekte des Lachens ein, denn «indem durch die ausgelösten Atembewegungen der Rückfluß des Blutes aus dem Hirn nach dem Herzen gehemmtwird«, ist das Lachen rein physiologisch ein «Schutzmittel gegen die Gefahren einer plötzlichen Druckmindernug des Hirns«. An die «lachen-erregenden Vorstellungen« verschwendet Brockhaus 1892 keinen Gedanken, während er 1996 immerhin eine «gehobene Stimmungslage« und spezifische soziale Beziehungen als Grnndlagen des Lachens ausmacht. Für Plato war das Schlechte lächerlich, für La Bruyère entspringt das Lachen intellektuellen Fehlleistungen, nach Bergson infantilen Wurzeln.
Freuds Triebökonomie rühmt
das Lachen als ersparten Vorstellungsaufwand und Lustgewinn, während Plessner
von einer «Reaktion auf den drohenden Verlust sozialer Orientierung« spricht.
Konrad Lorenz sieht im Lachen die Umdeutung der stammesgeschichtlich
älteren zähnefletschenden Droh- in eine
entwaffnende, «beschwichtigende Kontaktgebärde«. Der Hirndruck
hält offenbar unvermindert an. - (lex)
Lachen (9) Bei erwachsenen Personen wird das Lachen durch Ursachen erregt, welche von denen beträchtlich verschieden sind, welche während der Kindheit hinreichen. Diese Bemerkung ist aber kaum auf das Lächeln anwendbar.
Das Lachen ist in dieser Beziehung dem Weinen analog, welches bei Erwachsenen beinahe ganz auf geistige Trübsal beschränkt ist, während es bei Kindern durch körperliche Schmerzen oder irgendwelche Leiden ebensowohl erregt wird wie durch Furcht oder Wut.
Viele merkwürdige Erörterungen sind über die Ursache des Lachens bei erwachsenen Personen geschrieben worden. Der Gegenstand ist äußerst kompliziert. Irgend etwas nicht Zusammengehöriges oder Unerklärliches, das Erstaunenerregende oder auch ein gewisses Gefühl der Überlegenheit beim Lachenden, der dabei in einer glücklichen Geistesstimmung sich finden muß, scheint die häufigste Ursache zu sein.
Die Umstände dürfen nicht momentaner Natur sein; kein Armer wird lachen oder lächeln, wenn er plötzlich hört, daß ihm ein großes Vermögen vererbt worden ist. Wenn der Geist durch freudige Empfindungen stark erregt wird, und irgendein unerwartetes Ereignis oder ein unerwarteter Gedanke tritt ein, dann wird, wie Mr. Herbert Spencer bemerkt, »eine bedeutende Menge nervöser Energie plötzlich in ihrem Abflusse gehemmt, anstatt daß ihr gestattet würde, sich in der Erzeugung einer äquivalenten Menge von neuen Gedanken und Erregungen, welche im Entstehen begriffen waren, auszubreiten... Der Überschuß muß sich in irgendeiner andern Richtung Luft machen. Es erfolgt daher ein Ausfluß durch die motorischen Nerven auf verschiedene Klassen von Muskeln, und hierdurch werden die halb konvulsivischen Tätigkeiten erzeugt, die wir Lachen nennen.«
Eine sich auf diesen Punkt beziehende Beobachtung hat einer
meiner Korrespondenten während der letzten Belagerung von Paris gemacht,
nämlich daß die deutschen Soldaten nach starker
Erregung infolge des Umstands, daß sie äußerster
Gefahr ausgesetzt gewesen waren, besonders geneigt waren, bei dem geringsten
Scherze in lautes Lachen auszubrechen. - (dar)
Lachen (10) Einmal wollte Dionysios
Ball spielen — das tat er nämlich leidenschaftlich gern —, er legte sein
Gewand ab und reichte sein Schwert einem jungen Mann, in den er verliebt
war. Da sagte jemand aus seiner Umgebung im Scherz: »Wenigstens dem hier
vertraust du also dein Leben an!« DerJüngling lachte; Dionysios aber ließ
beide hinrichten, den einen, weil er einen Weg
gewiesen habe, wie man ihn aus dem Wege räumen könne, den anderen, weil
er durch sein Lachen diesen Worten zugestimmt habe. Als freilich die Strafe
vollzogen war, empfand er deshalb Schmerz wie niemals sonst in seinem Leben
— er hatte nämlich den umgebracht, den er heftig geliebt
hatte. - Cicero, nach (gsv)
Lachen (11) Weilen alles so vergänglich
ist, drumb muß man sich lustig machen, so viel man kann, denn man kompt
nicht zwey mal wieder, und ich glaube, daß unser herrgott auch lieber hat,
daß man ihm mit lust, als mit chagrin dient. Wenn weinen
den frieden machen könnte, wollte ich selber weinen, aber das hilft zu
nichts, also were es besser, zu lachen. - Liselotte von der Pfalz,
Briefe. Frankfurt am Main 1981 (it 428, zuerst ca. 1700)
Lachen (12) Man muß lachen, auch ehe
man glücklich ist, sonst stirbt man, ohne gelacht zu haben. -
(bru)
Lachen (13) »Wir sprachen über das Lachen«, erklärte der Blinde bündig. »Die Komödien wurden von Heiden geschrieben, um die Leute zum Lachen zu bringen, und das war schlecht. Unser Herr Jesus hat weder Komödien noch Fabeln erzählt, ausschließlich klare Gleichnisse, die uns allegorisch lehren, wie wir ins Paradies gelangen, und so soll es bleiben!«
»Ich frage mich«, sagte William, »warum Ihr so abweisend gegen den Gedanken seid, daß Jesus gelacht haben könnte. Ich für meinen Teil halte das Lachen durchaus für ein gutes Heilmittel, ähnlich dem Baden, um die schlechten Körpersäfte und andere Leiden des Körpers zu kurieren, insbesondere die Melancholie. «
»Das Baden ist eine gute Sache«, pflichtete Jorge ihm bei, »und selbst der Aquinate empfiehlt es als Mittel gegen die Trübsal, die eine schlimme Leidenschaft sein kann, wenn sie nicht aus einem Leiden kommt, das sich durch Tapferkeit überwinden läßt. Das Baden bringt die Körpersäfte ins Gleichgewicht. Das Lachen dagegen schüttelt den Körper, entstellt die Gesichtszüge und macht die Menschen den Affen gleich.«
»Die Affen lachen nicht, das Lachen ist dem Menschen eigentümlich, es ist ein Zeichen seiner Vernunft«, entgegnete William.
»Auch die Sprache ist ein Zeichen der menschlichen Vernunft, und mit der Sprache kann man Gott lästern! Nicht alles, was dem Menschen eigentümlich ist, ist deswegen auch schon gut. Das Lachen ist ein Zeichen der Dummheit. Wer lacht, glaubt nicht an das, worüber er lacht, aber er haßt es auch nicht. Wer also über das Böse lacht, zeigt damit, daß er nicht bereit ist, das Böse zu bekämpfen, und wer über das Gute lacht, zeigt damit, daß er die Kraft verkennt, dank welcher das Gute sich wie von selbst verbreitet. Darum heißt es in der Regel des heiligen Benedikt: ›Decimus humilitatis gradus est si non sit facilis ac promptus in risu, quia scriptum est: stultus in risu exaltat vocem suam.‹«
»Quintilian sagte«, unterbrach mein Meister, »im Panegyrikus müsse das Lachen zwar unterdrückt werden, um der Würde willen, aber in vielen anderen Fällen solle man es ermuntern. Plinius der Jüngere schrieb: ›Aliquando praeterea rideo, iocor, ludo, homo sum.‹«
»Sie waren Heiden«, versetzte Jorge. »Die Regel des heiligen Benedikt sagt: ›Scurrilitates vero vel verba otiosa et risum moventia aeterna clausura in omnibus locis damnamus, et ad talia eloquia discipulum aperire os non permittimus.‹«
»Aber zu einer Zeit, als das Wort Christi bereits auf Erden siegreich war, sagte Synesios von Kyrene, die Gottheit habe das Komische und das Tragische harmonisch zu verbinden gewußt, und Aelius Spartianus berichtet von Kaiser Hadrian, einem hochgebildeten Manne von naturaliter christlichem Geist, er habe Momente von Fröhlichkeit mit Momenten von Ernst zu mischen verstanden. Und Ausonius schließlich empfiehlt, Ernst und Spaß in wohlabgewogenem Maß zu dosieren. «
»Aber Paulinus von Nola und Clemens von Alexandria warnten vor dergleichen Dummheiten, und Sulpicius Severus berichtet, den heiligen Martin habe man weder je wütend gesehen noch jemals von lautem Gelächter geschüttelt.«
»Aber er berichtet auch von einigen höchst geistreichen Repliken des Heiligen.«
»Sie waren prompt und treffend, aber nicht komisch. Sankt Ephraim hat eine Paränese gegen das Lachen der Mönche geschrieben, und in De habitu et conversatione monachorum heißt es, Schamlosigkeiten und Witze seien zu meiden, als ob sie das Gift der Sandvipern wären.«
»Aber Hildebert von Lavardin sagte: ›Admittenda tibi joca sunt post seria quaedam, sed tamen et dignis ipsa gerenda rnodis.‹ Und Johann von Salisbury hat eine maßvolle Heiterkeit ausdrücklich erlaubt. Und schließlich der Ekklesiast, von dem Ihr selber soeben die Stelle zitiertet, auf welche sich Eure Ordensregel bezieht: Wenn er sagt: ›Der Dumme erhebt seine Stimme zu lautem Lachen‹, so akzeptiert er zumindest ein stilles Lachen, ein Lachen der heiteren Seele.«
»Die Seele ist heiter nur, wenn sie die Wahrheit
schaut und sich am vollendeten Schönen ergötzt, und über die Wahrheit und
Schönheit lacht man nicht. Eben darum hat Christus
niemals gelacht. Das Lachen schürt nur den Zweifel.«
- Umberto Eco, Der Name der Rose. München 1982 (zuerst 1980)
Lachen (14)
Faust; Lust, von unbändigem Lachen geschüttelt, wie der Vorhang aufgeht.
FAUST : Genug, Lust! Hören Sie auf! Hier wird nicht gelacht?
LUST hört auf zu lachen.
FAUST: Wenn Sie wüßten, was das Lachen ist l
Sie lacht noch heftiger.
FAUST : Genug, sage ich. . . Genug! Das ist ja nicht zum Aushalten. Oder gehen Sie in den Garten, und lachen Sie dort...
LUST: Verzeihung, Meister . . .
FAUST: Und worüber lachen Sie?
LUST : Ach . . . Das war nur so eine Idee.
FAUST: Was für eine Idee?
LUST wieder von Lachen geschüttelt: Ei.. .ne I.. .dee... Hört auf zu lachen. Da, sehen Sie? Eine Idee . . . Wie soll ich Ihnen das erklären? . . . Das ist überhaupt gar keine richtige Idee, glaube ich; und ich merke schon, daß ich wieder lachen müßte, wenn ich auf dieses Etwas in meinem Geiste zurückkäme, das mich alsbald von oben bis unten durchkitzelt . . . Denken Sie nur ja nicht, das Lachen machte mir Spaß . . . Das ist ein heftiger Schmerz! . . .
FAUST : Und mich stört es, und ich verliere meine Zeit damit, abzuwarten, bis Ihre Ladung urwüchsiger Kraft erschöpft ist.
LUST : Verzeihung, Meister ... Es ist ein wenig Ihre Schuld.
Ich weiß nur zu gut, was das Lachen ist. Sie haben mir neulich den Satz diktiert, das Lachen sei eine Verweigerung des Denkaktes, und die Seele entledige sich eines Bildes, das ihr unmöglich erscheint oder unter der Würde ihrer Funktion, . .. ebenso wie . . . wie der Magen sich dessen entledigt, wofür er keine Verantwortung übernehmen will, und zwar hier wie dort vermittels des gleichen Verfahrens einer groben Zuckung.
FAUST : Na und, stimmt das etwa nicht? Ist es nicht höchst bemerkenswert, daß Seele und Magen, um etwas . . . auszustoßen, gleicherweise ihre Zuflucht zu der rohen Kraft nehmen?
LUST : Ja, aber das Lachen ist weniger abstoßend.
FAUST: Das kommt auf den Lachenden an ... Doch wie war das mit Ihrer Idee?
LUST: Verzeihung, Meister . . . Ich mußte soeben ganz unversehens an Ihre vortreffliche Definition denken . . . Ich weiß nicht, was in Ihren Worten mich darauf brachte; und als ich auf den Ausdruck: grobe Zuckung, stieß, da kam mich, ich weiß nicht wie, das Lachen an, und schon war es um mich geschehen! . . . Jeder Widerstand war nutzlos. Zumal ich bei jedem Einhalt zu mir selber sprach: grobe Zuckung, grobe Zuckung . . . Da steht der Meister und beobachtet eine grobe Zuckung l ... Zu dumm, wirklich zu dumm! Und wieder packte mich das Lachen!
FAUST : So lachen Sie nur, lachen Sie nur!
Sie lacht.
FAUST : Als grobe Zuckung ist das gar nicht so übel. . . Was für hübsche weiße Zähne Sie zeigen, mein Fräulein! Und dieses schöne und wilde Zurückschleudern Ihres Halses, der sich da freimacht, ist ganz danach angetan, eine jener Verweigerungen des Denkaktes auszulösen, die wer weiß wohin führen . .. Hüten Sie sich, vor dem ersten besten zu lachen.
LUST: Aber, man sagt doch, das Lachen entwaffne .. .
FAUST: Was nicht besagt, daß es selber keine Waffe sei.
- Paul Valéry, Mein Faust. München 1963 (dtv sr 16, zuerst ca.
1940)
Lachen (15) Während des Krieges
ist Paul Scheerbart
gestorben; er hat sein Leben lang zuwenig gegessen
und zuviel getrunken. Das herrliche, mächtige,
Leib und Seele erschütternde
Lachen des einzigen großen Humoristen der modernen deutschen Literatur
ist stumm geworden. Ich denke an eine öffentliche Vorlesung, die er aus
seinen Werken halten sollte. Er las brillant, aber plötzlich übermannte
ihn sein eigener Humor. Er fing zu wackeln an, er fing zu prusten an, und
dann brach das Lachen mit einer solchen Urgewalt hervor, daß an kein Lesen
mehr zu denken war. Da stand ein deutscher Dichter auf dem Podium und lachte,
schüttelte sich, brüllte vor Lachen, und der ganze Zuhörerraum war angesteckt
von dem lachenden Dichter, bog sich und krähte.
- Erich Mühsam, Unpolitische Erinnerungen. Hamburg 2000 (zuerst ca.
1930)
Lachen (16) Wer lacht, streitet nicht. Das kann er auch gar nicht, denn der Körper befindet sich beim Lachen gewissermaßen im Ausnahmezustand. Bis zu 80 Muskeln gleichzeitig bewegt der Mensch, wenn er so hemmungslos lacht, dass ihm die Tränen in die Augen schießen - die übrigens biochemisch ganz anders zusammengesetzt sind als Tränen der Trauer und des Schmerzes. Was aber geschieht genau mit dem Körper beim Feixen, Kichern, Gickeln oder Gackern? Allein äußerlich schon mal recht viel: Die Schultern zucken, der Brustkorb bebt und das Zwerchell hüpft. Ein Muskel mit dem schönen Namen Musculus zygomaticus major sorgt dafür, dass sich die Mundwinkel nach oben ziehen. Auch innerlich gerät der Organismus aus der Ruhe: Das Herz fängt schneller an zu schlagen, der Blutdruck steigt und über die Atmung werden die Lungen vermehrt mit Sauerstoff versorgt, so wie man es vom Joggen oder Walken kennt. Dies kommt der Stimmung zugute, denn Sauerstoff in den Lungen bedeutet Sauerstoff im Gehirn.
Nach dem Lachen beruhigt sich der Organismus ziemlich schnell wieder.
Doch Stimmung und Nervensystem zehren noch weiter von der warmen Welle
Fröhlichkeit. Grund ist die vermehrte Ausschüttung von jenen Botenstoffen
im zentralen Nervensystem, die auch für die Stimmungsstabilisierung verantwortlich
sind, den sogenannten Glückshormonen. - Marion Hughes, Berliner Zeitung
vom 16. Februar 2006
Lachen (17) Von allen Arten
zu lachen, die genaugenommen keine sind, sondern eher zum Indianergeheul zu
zählen sind, verdienen meiner Meinung nach nur drei unsere Aufmerksamkeit, nämlich
das bittere, das falsche und das freudlose. Sie entsprechen aufeinanderfolgenden,
- wie soll ich es sagen, aufeinanderfolgenden . .. auf .. . aufeinanderfolgenden
Hautabschürfungen des Verstandes, und der Übergang vom einen zum anderen ist
der Übergang vom kleineren zum größeren, vom niederen zum höheren, vom äußeren
zum inneren, vom groben zum feinen, vom Stoff zur Form. Das heute freudlose
Lachen war einst falsch, das heute falsche Lachen war einst bitter. Und das
heute bittere Lachen? Zum Weinen, Mr. Watt, zum Weinen.
Aber wir wollen nicht unsere Zeit damit verschwenden, wir wollen nicht noch
mehr Zeit damit verschwenden, Mr. Watt. Nein, wirklich nicht. Wo waren wir stehengeblieben?
Das bittere, das falsche und - ha! ha! - das freudlose. Das bittere Lachen lacht
über das, was nicht gut ist, es ist das ethische Lachen. Das falsche Lachen
lacht über das, was nicht wahr ist, es ist das intellektuelle Lachen. Nicht
gut! Nicht wahr! Nun ja. Aber das freudlose Lachen ist das dianoetische Lachen,
durch den Rüssel - ha! - so. Es ist das Lachen, der risus purus, das über das
Lachen lachende Lachen, das verblüfft dem höchsten Witz
huldigt, mit einem Wort, das Lachen, das über das lacht, was - Ruhe, bitte!
- was unglücklich ist. - (wat)
Lachen (18) (risus)
ist ein psychophysischer Vorgang, der sich nach seiner physischen Seite hin
in stoßweise erfolgender konvulsivischer Ausatmung der Luft, die mit gleichartigen
Tönen der Stimme und fröhlichen Gesichtszügen verbunden ist, äußert. Beim Lachen
sind Nase und Augen weit geöffnet;
auch der Mund ist offen. Die Einatmung, welche die Ausbrüche
des Lachens unterbricht, erfolgt dagegen jedesmal in einem tiefen Zuge. Es entsteht
entweder durch körperliche Reizung (Kitzel) zur Ableitung
und Ausarbeitung eines den Zentralorganen durch Empfindungsnerven aufgedrungenen
Reizes, oder durch den Reiz des im Lächerlichen liegenden Kontrastes, um diesen
Reiz vom Sinne auf Rückenmarksbewegungsnerven zu entladen. In letzterem Falle
ist das Lachen ein Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung
in nichts. - Friedrich Kirchner, Wörterbuch
der philosophischen Grundbegriffe 1907
Lachen (19) Die besseren Scherze sind fehl am Platz. Zu lachen wissen über sein eigenes Lachen und sich über den Ernst amüsieren, mit dem die Menschen sich amüsieren. Könnte sie selbstbewußt sein, wäre die klassische Komik vollkommen, so sehr ist sie dumm (die Scherze Molières). Und diejenigen, die darüber mit vollem Bauche lachen (wenn sie einen Argwohn hegten), werden die wahren »Schelme« sein.
Der Humor ist nicht mehr als eine ziemlich stinkende Spielart der ordinären Komik. Er ist eine Wirkungskraft und genießt eine fast soziale Stellung.
Wir befinden uns ziemlich jenseits dieser weichgekochten Spielchen.
Wir sind beim erratenen Einverständnis und beim Geheimnis der Polichinelle, beim verweigerten und zugleich gekünstelten Lachen und beim verräterisch ermutigten Ernst, dem Genuß des reinen Schauspiels der Einfalt in seiner triumphalen Notwendigkeit.
Unser Zeichen, das ist der falsche Geist, das Gelegenheitsgedicht zur unpassenden Zeit, der verfehlte Scherz, der mitschuldige Ernst, der lahme Kalauer, der schlechte Geschmack, fein dick ...
Aber selbstverständlich sind das nur Zeichen, Augenblicke. Es handelt sich nicht darum, diese Mystifikation zweiten Grades emstzunehmen, noch daraus eine Komik zu machen -aber sie überhaupt entschrauben »und so weiter« (wie Achras sagte). Denn dieses kleine Spiel hat kein Ende. Bis zur Erschöpfung (des Spielers und des Spiels). Alfred Jarry.
Diejenigen, die ihn nicht drollig finden, haben recht. Seine Witze sind schwach,
sein Humor forciert, und selbst im zweiten Grad, wenn er augenscheinlich über
sein Publikum lacht, ist seine vorgegebene Komik schauerlich. Daher sein relativer
Mißerfolg, der für ihn übrigens ein Sieg bedeutet, den einzigen. Mißerfolg,
der zu einer Niederlage (oder Sieg, der zum Triumph) wird, selbst wenn man seine
Förderer betrachtet und ihre köstlichen Widersprüche, wenn sie sich zum Lachen
gezwungen glauben, - oder ein noch besserer Widerspruch, wenn sie spontan lachen.
Ah! Er hat sie gefoppt, alle. - Julien Torma, nach (jar)
Lachen (20) Das Lachen ist teuflisch,
folglich ist es zutiefst menschlich. Es ist die Folge der Idee des Menschen
von seiner eigenen Überlegenheit; und tatsächlich, da das Lachen im wesentlichen
menschlich ist, ist es im wesentlichen ein Widerspruch, das heißt, es ist gleichzeitig
ein Zeichen von unendlicher Armseligkeit, einer unendlichen Armseligkeit gegenüber
dem absoluten Höchsten Wesen, dessen Fähigkeit zu denken er besitzt, und einer
unendlichen Größe gegenüber den Tieren. Aus dem sich stets wiederholenden Zusammenprall
dieser beiden Unendlichkeiten löst sich das Lachen aus. Das Komische, der zwingende
Anstoß zum Lachen, liegt im Lachenden und keineswegs im Gegenstand des Lachens.
Es ist ja nicht der Mensch, welcher fällt, der über seinen eigenen Sturz lacht,
er sei denn Philosoph, somit einer, der durch Gewöhnung die Kraft erlangt hat,
sich rasch zu verdoppeln und als unbeteiligter Zuseher den Äußerungen seines
Ichs beizuwohnen. Der Fall ereignet sich jedoch selten. Die komischsten Tiere
sind die, welche die ernsthaftesten sind, so die Affen und die Papageien. -
(cb)
Lachen (21) Betrachtet man das Lachen physisch, oder in Ansehung des Leibes, so untersucht man das eigentliche Wesen, nebst den dazu gehörigen Umständen desselben. Der geringste Grad des Lachens, der sich durch eine ganz geringe Annäherung der Augenlieder gegen einander, und eine Verlängerung des Mundes, wobey seine Enden in die Höhe gezogen sind, verräth, wird Lächeln genannt; s. oben. Bey dem Lachen gehen beyde Winkel des Mundes zurück, und erheben sich ein wenig, der Obertheil der Wangen erhebt sich, und bey manchen Personen bemerkt man besondere Grübchen in den Wangen, welche die Dichter für den Sitz des Lachens und der Annehmlichkeit halten; die Augen schließen sich mehr oder weniger, die Ober=Lippe erhebt sich, die untere erniedrigt sich, der Mund öffnet sich, und die Haut der Nase faltet sich; ein geringerer Grad des Lachens besteht bloß in Verlängerung und Oeffnung des Mundes, ohne damit verbundenen Schall. Bey dem höchsten Grade des Lachens, dem laut schallenden, starken Lachen, dem so gen. Gelächter, oder dem Lachen aus vollem Halse, wird, nach einer tiefen Einathmung (Inspiration), der Mund aufgesperret, die Zähne werden entblößt, und bey erröthetem Gesicht, und öfters runzeliger Stirn, ist unter einem langen oft unterbrochenen Ausathmen, einer von den Selbst=Lauten a, e, i, o, stark und geschwinde hinter einander zu hören.
Was die Veränderungen, die durch jene Muskel=Bewegungen, welche das Lachen hervorbringen, in dem menschl. Körper vorgehen, betrifft, so haben Aerzte dafür gehalten, daß bey einem mäßigen Lachen die Bewegung des Blutes durch die Lungen befördert würde. Allein da, so lange das Lachen dauert, kein Einathmen geschieht, und das so oft unterbrochene Ausathmen unter dem Lachen, wo nicht länger dauert als ausserdem, doch gewiß eben so lange währt, so wird unter dem mäßigen Lachen die Luft in der Lunge nicht öfter, oder wohl gar nicht so oft, als sonst, erneuert, das Blut wird nicht mehr, wo nicht weniger, als sonst, abgekühlt. Es bleibt also immer etwas davon in der Lungen Pulsader zurück, wenn dasselbe unter dem mäßigen Lachen nicht so stark, wie sonst bey ordentlichem ruhigen Athemhohlen, abgekühlt und verdickt wird, und die Bewegung desselben durch die Lungen wird verhindert. Wird hingegen bey mäßigem Lachen das Blut eben so stark, als bey ruhigem Athemhohlen, abgekühlt und verdickt, so bleibt seine Bewegung durch die Lungen so, wie sie bey einem ruhigen Athmen unter der Freude ist. In keinem Falle wird also durch mäßiges Lachen die Bewegung des Blutes durch die Lungen befordert; wenn sie aber verhindert wird, so bringen einige tiefe Athemzüge nach geendigtem Lachen alles bald wieder ins Gleiche. Dauert das Lachen lange, so wird auch die Luft in den Lungen lange nicht erneuert, das Blut wird lange nicht abgekühlt und verdickt, es geht also nicht so viel in jedem Augenblicke daraus nach der linken Herz=Kammer zurück, als in eben der Zeit aus der rechten Herz=Kammer zugeführt wird; die Lungen=Pulsader, die rechte Herz=Kammer, und die Hohl=Ader, werden von Augenblick zu Augenblick mehr ausgedehnt, die Bewegung des Blutes aus den Puls=Adern in die Blut=Adern verhindert, und die lezten Endungen der Blut=Gefäße mit Blut vollgestopft. Daher entsteht bey dem starken Lachen die Röthe des Gesichtes, oft auch eine Beklemmung der Brust, die Thränen fließen aus den Augen, und zuweilen der Schweiß von der Stirn.
Ob ich nun gleich die schnellere Bewegung des Geblütes durch die Lunge unter währendem mäßigen Lachen läugne, so spreche ich ihm doch dadurch seinen Nutzen nicht ab; ich halte es vielmehr immer für nützlich, nur aus einem andern Grunde. Die Lunge ist ein Eingeweide, worein bey jedem Athemzuge eine Luft kommt, die kälter ist, als das Blut, welches in den Gefäßen dieses zum Leben nöthigen Organes sich bewegt, und dieses wird durch das Athemhohlen abgekühlt. Die Gefäße der Lunge selbst erfahren eben dasselbe. Nun werden die Wände der thierischen Gefäße durch die Abkühlung dichter, stärker, und ihr Durchmesser kleiner, und dieses bringen auch die zunehmenden Jahre zuwege. Die Lungen=Gefäße könnten also durch das so nöthige Athemhohlen, mit der täglich zunehmenden physischen Stärke derselben, allzu früh sich so verengern, daß die Bewegung des Blutes durch dieselben nicht mehr, wie es seyn sollte, geschehen könnte. Dieses Uebel verhütet das mäßige Lachen, indem durch dasselbe, sobald es die Abkühlung des Blutes in den Lungen verhindert, dieses sich in den Lungen=Gefäßen anhäuft, sich öffnet, ausdehnt, etwas schwächt, und auf diese Weise deren allzu frühe Steifigkeit verhindert.
Bisweilen hat die Freude Krankheiten allein durch das Lachen geheilt.
So findet man, daß Eiter=Geschwüre, selbst in der Lunge, durch das
Lachen zum Vortheil der Kranken geöffnet worden sind. Erasmus von Rotterdam verdankte eine Genesung dieser Art dem Lesen der Epistolarum obscurorum virorum. Pechlin
führt an, daß ein in die Lunge gestochener junger Mensch, der schon von
dem Arzte und Wund=Arzte verlassen war, als er, halb todt, die Mahlerey
von Licht=Schnuppen gesehen, die einige seiner Bekannten, die bey ihm
wachten, auf dem Gesichte des Jüngsten unter ihnen, der zu dem Fuße der
Bettstelle schlief, gemacht hatten, darüber gelacht, und hierdurch 3
Pfund ergossenes Blut aus seiner Wunde getrieben habe, und von Stunde
an erleichtert worden sey. - Johann
Georg Krünitz, Ökonomische Enzyklopädie oder allgemeines System
der Staats=, Stadt=, Haus= und Landwirthschaft 1773 bis 1858
Lachen (22)

- Otto
Dix (1924)
Lachen (23)

"Lachende Alte"
- Ernst Barlach 1937, nach:
Ernst Barlach mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, dargestellt von Catherine
Krahmer. Reinbek bei Hamburg 1984 (rm 335)
Lachen (24)
Ingrid lacht. Ingrid lachte so vor sich hin. Sie saß an Luv auf dem
Bordrand, hielt die Fockschot ein bißchen fest, in ihrem Nacken fühlte sie den
Wind und die Sonne wühlen und sie lachte so leise am Groß-Segel hinauf. Das
war sehr hoch, und von der zweitletzten Steiflatte fing das Lachen an zu springen,
sprang bis zum Stander hinauf und von da auf eine kleine lustige Wolke, die
sich atemlos langsam entlangschob zwischen dem leuchtenden Weiß und Blau von
Himmel und Segel; dort saß nun das Lachen und freute sich. - Uwe Johnson,
Ingrid Babendererde. Nach (enc)
Lachen (25)
Katzenberger erklärte gern ohne Neid der nächsten Tisch-Ecke, daß er als
Arzt über Bühnen-Skribenten seine eigne Meinung habe, und folglich eine diätetische.
Ein Lustspiel an und für sich, fuhr er fort, verwerfe niemand weniger als er;
denn es errege häufig Lachen, und wie oft durch solches Lachen Lungengeschwüre,
englische Krankheit nach Tissot, Ekel (wenn auch nicht gerade der am Stücke
selber), ja durch bloße Spaß-Vorreden Rheumatismen gehoben worden, wiss' er
ganz gut. — Ja, da Tissot eine Frau anführe, die nicht eher als nach dem Lachen
Stühle gehabt, so halt' er allerdings ernsthaft einen Sitz im Komödienhause
für so gut als ein treibendes Mittel, so daß jeder aus seiner Leidengeschichte,
wie man sonst bei einer andern getan, ein Lustspiel machen könnte. — Daher,
wie der Quacksalber gern einen Hanswurst, so sehe der Arzt gern einen Lustspieldichter
bei sich, damit beider Arzneien nach Verhältnis ihres Werts von gleichmäßigen
Spaßen unterstützt und eingeflößt würden. - (katz)
Lachen (26)
Lachen (27)
Wir sind das erste studierte Zeitalter in puncto der „Kostüme", ich
meine der Moralen, Glaubensartikel, Kunstgeschmäcker und Religionen, vorbereitet,
wie noch keine Zeit es war, zum Carneval großen Stils,
zum geistigsten Faschingsgelächter und Übermut, zur
transcendentalen Höhe des höchsten Blödsinns und
der aristophanischen Weltverspottung. Vielleicht, daß wir hier gerade das Reich
unserer Erfindung noch entdecken, jenes Reich, wo auch wir noch Original sein
können, etwa als Parodisten der Weltgeschichte und Hanswürste
Gottes — vielleicht, daß, wenn auch nichts von heute sonst Zukunft hat, doch
gerade unser Lachen noch Zukunft hat! Friedrich Nietzsche, Jenseits
von Gut und Böse
Lachen (28) Der Mensch hat Ehrfurcht vor der Sprache und betet das Denken an; öffnet er den Mund, dann sieht man seine Zunge unter einem Glassturz, und das Naphthalin seines Gehirns verpestet die Luft.
Für uns ist alles eine Gelegenheit zur Belustigung. Wenn wir lachen, dann entleeren wir uns, und der Wind springt in uns über, bewegt Türen und Fenster und führt die Nacht des Windes in uns ein.
Wind. Die vor uns gekommen sind, sind Künstler. Die anderen sind Bösewichte. Machen wir uns die Bösewichte zunutze, stellen wir uns und auch den Schwachsinnigen an die Stelle des Kopfes und der Hand.
Wir brauchen Zerstreuungen. Wir werden bleiben, was wir sind oder sein werden.
Wir brauchen einen freien und leeren Körper, und wir brauchen nichts.
- Paul Eluard, nach: Dada - eine literarische Dokumentation. Hg. Richard
Huelsenbeck. Reinbek bei Hamburg 1964
Lachen (29) Wie im Ungehorsame Adams die heilige und keusche Natur zu erzeugen in eine andere Art fleischlicher Lust verändert wurde, so wurde auch die Stimme höherer Freuden, die Adam ebenfalls innewohnte, in die entgegengesetzte Art des Lachens und schallenden Gelächters verkehrt. Die unpassende Freude nämlich und das Lachen hat eine gewisse Gemeinschaft mit der Fleischeslust und daher erschüttert der Wind, der das Lachen hervorruft, vom Marke des Menschen ausgehend auch dessen Schenkel und Eingeweide. Und zuweilen entlockt das Lachen durch die allzu heftige Erschütterung vom Blute der Adern den Augen Tränenwasser, so wie auch manchmal vom Blute der Adern durch die Glut der Lust der Schaum menschlichen Samens ausgeworfen wird.
Fühlt die Erkenntnis eines Menschen keine Traurigkeit,
nichts Widriges und nichts Böses in sich, dann öffnet sich das Herz dieses
Menschen der Freude, so wie sich die Blumen der
Sonnenwärme entgegen öffnen. Alsbald nimmt die Leber
diese Freude in sich auf und hält sie in sich fest wie der Magen
die Speise. Und wenn der Mensch also vom Guten oder Bösen, das ihm gefällt,
erfreut wird, dann tritt der obenerwähnte Wind zuweilen aus dem Marke aus,
berührt zuerst den Schenkel, setzt sich dann
in der Milz fest, erfüllt deren Adern, breitet sich
zum Herzen hin aus, erfüllt die Leber und macht den Menschen lachen und
läßt seine Stimme wie die der Tiere ertönen in schallendem Gelächter.
Ein Mensch, der in seinen Gedanken wie der Wind leicht hier- und dorthin
geworfen wird, bekommt eine etwas dicke Milz, freut sich leicht und lacht
leicht. Und wie die Traurigkeit und der Zorn den
Menschen schwächt und austrocknet, so verletzt auch unmäßiges Lachen die
Milz, schwächt den Magen und verteilt durch seine Erschütterung die Säfte
in unrichtiger Weise. - (bin)
Lachen (30) PSYCHOLOGIE. Das Lächerliche ist nicht beißend. Lachen ist ein Krampf. Die Ursache des Lachens muß also von einer plötzlichen Entladung der gespannten Aufmercksamkeit - durch einen Contrast emstehn. Aehnlichkeit mit dem electrischen Funken. Der ächte Komicker muß ernsthaft und wichtig aussehn, wenn er eine Posse macht, (Ironie. Parodie. Travestie - Die Verkleidung ist ein HauptBestandtheil des Lächerlichen. Wortspiele. Lächerliche Fragen und Antworten. Anecdoten. Scenen. Shakespeare. Die Italiaener. Aristophanes. Witz der gemeinen Leute. Carricaturen. Hogarth. Lichtenberg.)
Lachen - Kur der Hypochondrie. Aus vielen Lachen und Witzeln kann aber auch
Hypochondrie entstehn. Lachen bekömmt athenischen Constitutionen vorzüglich
gut. Alles was die Aufmercksamkeit erregt und nicht befriedigt ist lächerlich.
Nur das Plötzliche Abspannen der Aufmercksamkeit ist aber die eigentlich lachenmachende
Operation. Das Weinen ist eine sthenische Krisis - das Rührende ist das Gegentheil
des Lächerlichen. Das Rührende fängt mit Abspannung an - und spannt plötzlich
- das Rührende oder das Eindringende dringt schnell ein - eh man Zeit hat sich
zu fassen - Es ist eine Übersättigung - Weichwerden - zerfließen
- schmelzen. Jenes ist ein Absonderungs, dies ein Einschluckungsprocess - Jenes
ein Flüchtigwerden - daher die Kälte des Lächerlichen. Dies ein Gerinnen - ein
Starrwerden - daher die Wärme. Das Weinen und Lachen mit ihren Modificationen
gehören so zum Seelenleben, wie Essen und Secerniren
zum körperlichen Leben. Das Weinen macht das arterielle - das Lachen das venöse
System. - (bro)
Lachen (31)
Das Lachen entsteht jedesmal aus nichts Anderm, als aus der plötzlich
wahrgenommenen Inkongruenz zwischen einem Begriff und den realen Objekten, die
durch ihn, in irgend einer Beziehung, gedacht worden waren, und es ist selbst
eben nur der Ausdruck dieser Inkongruenz. Sie tritt oft dadurch hervor, daß
zwei oder mehrere reale Objekte durch einen Begriff gedacht und seine Identität
auf sie übertragen wird; darauf aber eine gänzliche Verschiedenheit derselben
im Uebri-gen es auffallend macht, daß der Begriff nur in einer einseitigen Rücksicht
auf sie paßte. Eben so oft jedoch ist es ein einziges reales Objekt, dessen
Inkongruenz zu dem Begriff, dem es einerseits mit Recht subsumirt worden, plötzlich
fühlbar wird. Je richtiger nun einerseits die Subsumtion solcher Wirklichkeiten
unter den Begriff ist, und je größer und greller andererseits ihre Unangemessenheit
zu ihm, desto stärker ist die aus diesem Gegensatz entspringende Wirkung des
Lächerlichen. Jedes Lachen also entsteht auf Anlaß einer paradoxen und daher
unerwarteten Subsumtion; gleichviel ob diese durch Worte, oder Thaten sich ausspricht.
- (wv)
Lachen (32)
- N.N.
Lachen (33)
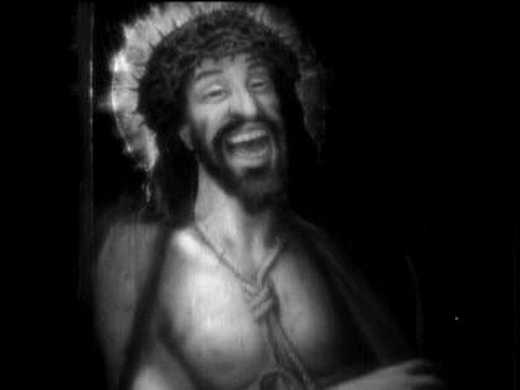
- Aus: Luis Bunuel. Nazarin (1959), nach: Max Aub / Luis Buñuel, Die Erotik und andere Gespenster.
Berlin 1986
Lachen (34)
Nachtheilig wirkt das Lachen bey Vollblütigen und bey solchen
Individuen die eine Neigung zu Entzündungskrankheiten oder zur Apoplexie
haben, die sehr reizbar und von zartem Körperbau sind, die an
Lungenkrankheiten, Bluthusten, Blutbrechen und anderen Hämorrhagien
leiden … bey Gebärenden und Wöchnerinnen, und bey vorhandenen Vorfällen
und Hernien. Gänzlich muß endlich das Lachen bey solchen Menschen
vermieden werden, die an Herzkrankheiten und Anevrysmen leiden. Man hat
sehr viele Fälle, wo das Lachen plötzlichen Tod bewirkte, aufgezeichnet.
– Darstellung
des menschlichen Gemüths in seinen Beziehungen zum geistigen und
leiblichen Leben: für Ärzte und Nichtärzte höherer Bildung, Band 2, Carl Gerold, 1825,
nach -
Wikipedia
Lachen (35) Durch einige Affekten wird die Gesundheit von der Natur mechanisch befördert. Dahin gehört vornehmlich das Lachen und das Weinen. Der Zorn, wenn man (doch ohne Widerstand zu besorgen) brav schelten darf, ist zwar auch ein ziemlich sicheres Mittel zur Verdauung, und manche Hausfrau hat keine andere innigliche Motion, als das Ausschelten der Kinder und des Gesindes, wie dann auch, wenn sich Kinder und Gesinde nur hiebei geduldig betragen4, eine angenehme Müdigkeit die Lebenskraft durch die Maschine sich gleichförmig verbreitet; aber ohne Gefahr ist dieses Mittel doch auch nicht wegen des besorglichen Widerstandes jener Hausgenossen.
Das gutmütige (nicht hämische, mit Bitterkeit verbundene) Lachen ist
dagegen beliebter und gedeihlicher: nämlich das, was man jenem persischen König
hätte empfehlen sollen, der einen Preis für den aussetzte, »welcher ein neues
Vergnügen erfinden würde«. - Die dabei stoßweise (gleichsam konvulsivisch)
geschehende Ausatmung der Luft (von welcher das Niesen
nur ein kleiner, doch auch belebender Effekt ist, wenn ihr Schall unverhalten
ertönen darf) stärkt durch die heilsame Bewegung des Zwerchfells das
Gefühl der Lebenskraft. Es mag nun ein gedungener
Possenreißer (Harlekin) sein, der uns zu lachen macht, oder ein zur Gesellschaft
der Freunde gehörender durchtriebener Schalk, der nichts Arges im Sinn zu haben
scheint, »der es hinter den Ohren hat« und nicht mitlacht, sondern mit scheinbarer
Einfalt eine gespannte Erwartung (wie eine gespannte Saite) plötzlich losläßt:
so ist das Lachen immer Schwingung der Muskeln, die zur Verdauung gehören,
welche dieses weit besser befördert, als es die Weisheit des Arztes
tun würde. Auch3 eine große Albernheit einer fehlgreifenden Urteilskraft4 kann
- freilich aber auf Kosten des vermeintlich Klügern - eben dieselbe Wirkung
tun. - Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht (zuerst 1798/1800)
Lachen (36) Er betrat das Plaza durch die
Bartür, und der Barmann lächelte zu seiner Begrüßung, hielt, eine
Flasche in der Hand, bei seinem Anblick inne; auf die Theke gestützt,
dem Eingang zugewandt, ein Knie an der Samthose von Ana Maria,
betrunken, eine Hand herabhängend auf das Revers eines zu gut
gekleideten Mannes, lachte Marcos. Er hatte dieses Lachen erfunden, um
sich zu helfen, und zwang es, ihm den Mund zu füllen und sich über das
Gesicht, den glänzenden Schweiß auszubreiten. Er lachte leise, ohne
Unterbrechung, ohne damit irgend etwas ausdrücken zu wollen, so als
fühle er sich durch das Lachen verborgen und fürchte, es zu rasch
aufzubrauchen. - Juan Carlos Onetti, Leichensammler. Frankfurt am Main 2001
Lachen (37) Alles ist Lachen (Anlaß
zu Gelächter), und alles Staub, und alles das Nichts / Denn alles Werdende stammt aus Vernunftlosem.
- Glykon, nach (licht)


 |
||
 |
||
 |
 |
|
 |
||


 |
||
 
|
  |
|
|
|
||