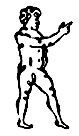 ommentar Sofern
die Natur, wie von zuständiger Seite behauptet wird, in irgendeiner Weise
die Gestalt des Kommentators in ihre Pläne einbegriffen hat, so bedeutet dies,
daß sie selbst Teilhaberin ist an diesem göttlich eingehauchten Impuls, Kommentare
herzustellen. Das Problem, ob eine spezifische Kommentierungsbefähigung in der
Natur selbst anzunehmen sei, hat die Gelehrten in vielfacher Weise beschäftigt,
und es ist notwendig, eine Probe zu geben von den zahlreichen Phantastereien
und Schlaumeiereien, die in diesem Zusammenhang gedacht, diskutiert, monologisiert
und geschrieben worden sind.
ommentar Sofern
die Natur, wie von zuständiger Seite behauptet wird, in irgendeiner Weise
die Gestalt des Kommentators in ihre Pläne einbegriffen hat, so bedeutet dies,
daß sie selbst Teilhaberin ist an diesem göttlich eingehauchten Impuls, Kommentare
herzustellen. Das Problem, ob eine spezifische Kommentierungsbefähigung in der
Natur selbst anzunehmen sei, hat die Gelehrten in vielfacher Weise beschäftigt,
und es ist notwendig, eine Probe zu geben von den zahlreichen Phantastereien
und Schlaumeiereien, die in diesem Zusammenhang gedacht, diskutiert, monologisiert
und geschrieben worden sind.
Die seltsamste Theorie, die, falls sie gut begründet
ist, das traditionelle Bild vom Wesen des Kommentars radikal umstürzen könnte,
wird etwa folgenderweise vorgebracht: Worte, die geschrieben, monologisiert,
dialogisiert werden, stellen alle zusammen eines der offensichtlich literarischsten
und linguistischsten Mittel dar, um den Bedürfnissen des Kommentators nachzukommen:
jedoch nicht das einzige und auch nicht das wichtigste; vielmehr, gesetzt den
Fall, daß die weitere Erzeugung von Kommentatoren gänzlich aufhören oder verkümmern
sollte, so würden deshalb die Kommentare selbst nicht ausfallen. Sie dauern
also weiter: sofern der Text sich einer so täuschenden und aggressiven Erscheinung
erfreut, daß er buchstäblich nirgends und überall sein kann, weshalb denn dieser
schweigsame Phantomas uns allüberall gegenübertritt, und das gesamte Universum
bietet ja Winkelgäßchen für seinen Hinterhalt; woraus folgt, daß der Kontakt
mit dem verschiedenartig dialektischen Text, der sich im Kommentar verkörpert,
wie immer man ihn auch verstehen mag — als Herausforderung, Provokation, Schmähung,
Umarmung, Marketender-Beischlaf, verliebtes Gefummel,
dialektische Ehrabschneiderei, chirurgisches Sondieren — sich überall herstellt
und nicht nur dort, wo der Kommentator es sich aussucht, vorschlägt und sich
zum Kontakt bereitmacht, Und sie pochen darauf: der Leib des Menschen ist angefüllt
mit Höhlen, Kavernen, Einbuchtungen, Auswüchsen und Dickichten; und durch die
Schenkelsäulen, die Kniekuppeln, die Lendenebenen, die Ohrspitzen, die nachdenklichen
Photosphären der Augen, ist dieser Leib, diese Fleischmaschine, dieser Haut-und
Knochen-Temenos, dieses behaarte Chartres über und über bekritzelt mit winzigen,
larvenhaften aber unbezweifelbaren Schriftzeichen. Muß man das geometrische
Monologisieren der Handflächen erwähnen, das gelehrte Kryptogramm der Runzeln,
die Echo-Haine der Fettbrust, die Aufteilungen der Hinterbacken, die spermatischen
Ethymologien, abgesehen von der lückenhaften Elfenbeinkette des Mundes, zwischen
die sich die Fleischhalbinsel drängt, eingetunkt in einen abgestandenen Speichel
von Bedeutungen? Ist daher nicht vielleicht unser Leib Indiz, Warnung, Zeichen,
vielleicht von Gott zusammengestellter Brief; sind wir vielleicht nicht Botschaften
mit Eigenantrieb, Räumungs-Telegramme, schmerbäuchige Episteln, blutige Predigten,
psychologisierte Liebesbriefchen, vagabundierende Visitenkarten, nächtliche
Lichtpausen? Und was bedeutet dies unser Geschriebensein anderes als eine geniale
Publikationsform eines lebendigen und lebhaften Kommentars? Und da ein jeglicher
von uns ganz geschrieben ist, könnte jeder Leib, in Leder gebunden, sich als
Einzelband eines großen Werkes vorstellen, oder doch als farbige Wochenheftlieferung
einer Universal-Enzyklopädie; unser geselliges Zusammenrotten käme dann aus
Impulsen unserer graphischen Körper auf eine Anordnung zu, in der, wenn auch
nur für kurze Augenblicke, die Gegenüberstellung der Todgeweihten einen flüchtigen
aber feierlichen Aphorismus schriebe, oder vielleicht Kapitel oder Buch, dessen
wir, die Träger, uns gänzlich unbewußt sind, wenngleich manche den Verdacht
hegen, daß dies Buch nicht weniger inexistent als sinnvoll sei.
- Giorgio Manganelli, Omegabet. Frankfurt
am Main 1988 (zuerst 1969)
Kommentar (2) Bild und Sprache sind
Komplizen. Wenn es so anstachelt, in einem Spiegel
auf den Zentimeter genau zu messen, wie viel Fleisch sein eigenes Fleisch aufnehmen
kann, dann weil der Anblick auch als Vorwand für Kommentare dient. »Hoppla!
Wie schön er gleitet! Wie weit er hineingeht!« - »Warte, ich lasse ihn noch
draußen, damit du ihn besser sehen kannst, ich stopfe dich nachher...« Jacques
und ich führen gerne einen Dialog, der sich durch Sachlichkeit auszeichnet.
Wenn das Vokabular obszön und begrenzt ist, dann weniger um einander aufzugellen
und uns gegenseitig an Obszönitäten zu übertreffen, sondern weil wir exakt sein
wollen bei der Beschreibung. »Spürst du, wie nass sie ist? Mir läuft es schön
an den Schenkeln runter, und die kleine Klit ist
ganz geschwollen.« - »Dieser Arsch, wie schön er
zappelt! Er will den Schwanz, was? Ja, er will ihn!« - »Ja, aber davor will
ich noch die Eichel an meiner Klit spüren. Soll ich sie auf der Klit reiben?«
- »Ja, und dann stopfe ich dir den Arsch!« - Das tut
gut... Und dir? Tut es deinem Schwanz gut?« - »Ja, das tut ihm gut.« - »Ziehen
sich auch deine Eier zusammen?« - »Ja, das zieht gut an den Eiern. O ja! Aber
ich ramme ihn dir noch mal richtig in den Arsch!« Dieser Dialog geht in gleich
bleibend ruhigem Ton weiter, sogar wenn wir uns dem Ende nähern. Da wir nicht
immer zur gleichen Zeit dasselbe sehen und fühlen, sprechen wir miteinander,
um in gewisser Weise unsere jeweiligen Informationen zu vervollständigen, ähnlich
wie zwei Synchronisten, die auf dem Bildschirm die Handlungen der Personen sehen,
denen sie ihre Stimme geben: Wir lösen durch unsere Worte die Protagonisten
in einem Porno ab, der vor unseren Augen läuft, und diese Protagonisten sind
Arsch, Möse, Eier
und Schwanz. - Catherine Millet, Das sexuelle Leben der
Catherine M. München 2001
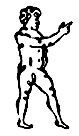 ommentar Sofern
die Natur, wie von zuständiger Seite behauptet wird, in irgendeiner Weise
die Gestalt des Kommentators in ihre Pläne einbegriffen hat, so bedeutet dies,
daß sie selbst Teilhaberin ist an diesem göttlich eingehauchten Impuls, Kommentare
herzustellen. Das Problem, ob eine spezifische Kommentierungsbefähigung in der
Natur selbst anzunehmen sei, hat die Gelehrten in vielfacher Weise beschäftigt,
und es ist notwendig, eine Probe zu geben von den zahlreichen Phantastereien
und Schlaumeiereien, die in diesem Zusammenhang gedacht, diskutiert, monologisiert
und geschrieben worden sind.
ommentar Sofern
die Natur, wie von zuständiger Seite behauptet wird, in irgendeiner Weise
die Gestalt des Kommentators in ihre Pläne einbegriffen hat, so bedeutet dies,
daß sie selbst Teilhaberin ist an diesem göttlich eingehauchten Impuls, Kommentare
herzustellen. Das Problem, ob eine spezifische Kommentierungsbefähigung in der
Natur selbst anzunehmen sei, hat die Gelehrten in vielfacher Weise beschäftigt,
und es ist notwendig, eine Probe zu geben von den zahlreichen Phantastereien
und Schlaumeiereien, die in diesem Zusammenhang gedacht, diskutiert, monologisiert
und geschrieben worden sind.










