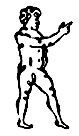 olonie Villegaignon
gründet auf einer in der Bucht gelegenen Insel Fort Coligny; die Indianer erbauen
es und versorgen die kleine Kolonie mit Lebensmitteln; aber bald verdrießt es
sie, immer nur zu geben, ohne etwas zu erhalten, und sie verschwinden aus ihren
Dörfern. Hungersnot und Krankheiten brechen in der Festung aus. Villegaignons
tyrannisches Temperament beginnt sich zu regen; die Sträflinge lehnen sich auf:
sie werden niedergemetzelt. Die Seuche greift auf das Festland über: die wenigen
Indianer, die der Mission treu geblieben sind, werden angesteckt. Achthundert
von ihnen kommen auf diese Weise ums Leben.
olonie Villegaignon
gründet auf einer in der Bucht gelegenen Insel Fort Coligny; die Indianer erbauen
es und versorgen die kleine Kolonie mit Lebensmitteln; aber bald verdrießt es
sie, immer nur zu geben, ohne etwas zu erhalten, und sie verschwinden aus ihren
Dörfern. Hungersnot und Krankheiten brechen in der Festung aus. Villegaignons
tyrannisches Temperament beginnt sich zu regen; die Sträflinge lehnen sich auf:
sie werden niedergemetzelt. Die Seuche greift auf das Festland über: die wenigen
Indianer, die der Mission treu geblieben sind, werden angesteckt. Achthundert
von ihnen kommen auf diese Weise ums Leben.
Villegaignon, der irdische Angelegenheiten verachtet, stürzt in eine
geistige Krise. Das Zusammenleben mit den Protestanten führt zu seiner Bekehrung,
und er bittet Calvin, Missionare zu schicken, die ihm den neuen Glauben
erklären sollen. So wird 1556 jene Reise organisiert, an der auch Léry teilnimmt.
Die Geschichte nimmt nun eine so seltsame Wendung, daß ich mich wundere,
daß noch kein Romanschreiber oder Drehbuchautor sich ihrer angenommen hat. Welch
einen Film würde sie abgeben! Isoliert auf einem Kontinent, der ihnen so unbekannt
ist wie ein anderer Planet; ohne jede Kenntnis seiner Natur und seiner Bewohner;
unfähig, den Boden zu bebauen, um sich zu ernähren; in allem, was sie brauchen,
von einer ihnen unbegreiflichen Bevölkerung abhängig, die sie außerdem haßt;
von Krankheiten heimgesucht - in dieser Situation sieht sich jene Handvoll Franzosen,
die allen Gefahren getrotzt haben, um den Verfolgungen in ihrer Heimat zu entrinnen
und eine Heimstatt zu gründen, in der die verschiedenen religiösen Überzeugungen
in Freiheit und Toleranz nebeneinander bestehen können, nun in ihrer eigenen
Falle gefangen. Die Protestanten versuchen, die Katholiken zu bekehren, und
umgekehrt. Statt für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten, verbringen sie viele
Wochen mit wahnwitzigen Diskussionen: wie ist das Abendmahl zu deuten? Darf
man bei der Heiligen Handlung den Wein mit Wasser vermischen? Die Eucharistie,
die Taufe werden zum Gegenstand wahrer theologischer Turniere, nach denen Villegaignon
entweder konvertiert oder widerruft.
Man geht sogar so weit, einen Abgesandten nach Europa zu schicken, der Calvin
um Rat fragen und ihm die strittigen Punkte zur Entscheidung vorlegen soll.
Unterdessen verdoppeln sich die Konflikte. Villegaignons geistige Fähigkeiten
lassen nach; Léry berichtet, daß man aus der Farbe seiner Kleider auf seine
Launen und Wutausbrüche schließen konnte. Zum Schluß wendet er sich gegen die
Protestanten und versucht, sie auszuhungern; diese nehmen nicht mehr am gemeinsamen
Leben teil, flüchten sich auf das Festland und verbünden sich mit den Indianern.
Der Idylle, die sich zwischen ihnen entspinnt, verdanken wir ein Meisterwerk
der ethnographischen Literatur: Voyage faict en la Terre du Brésil von
Jean de Léry. Das Abenteuer findet ein trauriges Ende; zwar gelingt es
den Genfern, wenn auch unter großen Schwierigkeiten, an Bord eines französischen
Schiffs zurückzukehren; doch anders als auf der Hinfahrt, da sie bei Kräften
waren, kann nicht mehr die Rede davon sein, frischfröhlich alle Schiffe zu plündern,
denen man unterwegs begegnet; an Bord herrscht Hungersnot. Schließlich ißt man
die mitgeführten Affen, ebenso die Papageien,
die so kostbar sind, daß eine mit Lery befreundete Indianerin den ihren nur
gegen ein Stück der Artillerie hergeben will. Die Mäuse und Ratten aus den Lagerräumen,
die letzten vorhandenen Lebensmittel, werden zu vier Ecu pro Stück gehandelt.
Es gibt kein Wasser mehr. Halb verhungert erreicht die Besatzung im Jahre 1558
endlich die Bretagne.
Auf der Insel zerfällt die Kolonie in einem Klima der Hinrichtungen und des
Terrors; von allen gehaßt, von den einen als Verräter, von den anderen als Renegat
betrachtet, von den Indianern gefürchtet und schließlich von den Portugiesen
in Angst und Schrecken versetzt, muß Villegaignon auf seine Träume verzichten.
Fort Coligny, das nun sein Neffe, Bois-le-Comte, befehligt, fällt 1560 in die
Hände der Portugiesen. - (str2)
Kolonie (2) Ich dachte an dieses
besiegte Volk, in dessen Mitte wir wohnen - oder vielmehr: das unter uns wohnt
—, dessen Sprache wir zu sprechen beginnen, dem wir beim täglichen Leben unter
der durchsichtigen Leinwand seiner Zelte zuschauen, dem wir unsere Gesetze aufzwingen,
unsere Ordnungen, unsere Bräuche und über das wir nichts wissen, rein nichts,
verstehen Sie, so als wären wir gar nicht zugegen und seit bald sechzig Jahren
einzig damit beschäftigt, es zu beobachten. Wir wissen weder, was sich in der
Laubhütte oder unter dem kleinen Stoffkegel abspielt, der zwanzig Meter von
unserer Tür mit Pflöcken in die Erde genagelt ist, noch was die sogenannten
zivilisierten Araber in den maurischen Häusern von Algier machen, was sie denken,
wer sie sind. Hinter den kalkgeschlämmten Mauern ihrer Stadthäuser, hinter der
Flechtwand ihres Gourbi oder hinter dem dünnen braunen Vorhang aus Kamelhaar,
daran der Wind rüttelt, leben sie ganz in unserer Nähe, unbekannt, geheimnisvoll,
verlogen, heimtückisch, unterwürfig, lächelnd, undurchdringlich. Ich sage Ihnen,
wenn ich von weitem durch mein Fernglas auf ihr benachbartes Lager blicke, wird
mir klar, daß sie Aberglauben, Zeremonien, tausend Bräuche haben, die wir noch
nicht kennen, nicht einmal vermuten! Niemals vielleicht hat ein durch Gewalt
unterworfenes Volk sich so vollständig der wirklichen Beherrschung, dem moralischen
Einfluß und dem erbitterten, aber nutzlosen Forschen des Siegers zu entziehen
gewußt. - (nov)
Kolonie (3)
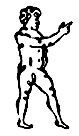 olonie Villegaignon
gründet auf einer in der Bucht gelegenen Insel Fort Coligny; die Indianer erbauen
es und versorgen die kleine Kolonie mit Lebensmitteln; aber bald verdrießt es
sie, immer nur zu geben, ohne etwas zu erhalten, und sie verschwinden aus ihren
Dörfern. Hungersnot und Krankheiten brechen in der Festung aus. Villegaignons
tyrannisches Temperament beginnt sich zu regen; die Sträflinge lehnen sich auf:
sie werden niedergemetzelt. Die Seuche greift auf das Festland über: die wenigen
Indianer, die der Mission treu geblieben sind, werden angesteckt. Achthundert
von ihnen kommen auf diese Weise ums Leben.
olonie Villegaignon
gründet auf einer in der Bucht gelegenen Insel Fort Coligny; die Indianer erbauen
es und versorgen die kleine Kolonie mit Lebensmitteln; aber bald verdrießt es
sie, immer nur zu geben, ohne etwas zu erhalten, und sie verschwinden aus ihren
Dörfern. Hungersnot und Krankheiten brechen in der Festung aus. Villegaignons
tyrannisches Temperament beginnt sich zu regen; die Sträflinge lehnen sich auf:
sie werden niedergemetzelt. Die Seuche greift auf das Festland über: die wenigen
Indianer, die der Mission treu geblieben sind, werden angesteckt. Achthundert
von ihnen kommen auf diese Weise ums Leben.










