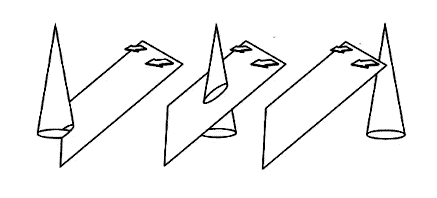edächtnis
In einem kleinen Kurort in der Nähe der majestätischen Iguaçufälle
im sogenannten mesopotamischen Gebiet an der Grenze zwischen
Argentinien, Brasilien und Paraguay erholte sich der große
zeitgenössische amerikanische Neurophysiologe Geoffrey
Sonnabend von schwerer körperlicher Erschöpfung und einer
Art Nervenzusammenbruch (zum Teil Folge des Scheiterns seiner
früheren Untersuchungen über die Gedächtnisbahnen bei Karpfen).
Am Abend hatte er ein Konzert der großen rumänisch-amerikanischen
Sängerin Madalena Delani besucht, die Lieder der deutschen Romantik
vortrug. Die Delani, damals eine der führenden Solistinnen auf
internationalen Gastspielen, hatte wiederholt Lob von Fachleuten
wie dem Musikkritiker der New York Times, Sidney Soledon, geerntet.
Dieser äußerte die Vermutung, das unvergleichlich schwermütige
Timbre ihrer Stimme - er nannte sie »durchtränkt von einem Gefühl
der Verlorenheit« - sei möglicherweise darauf zurückzuführen,
daß die Sängerin an einer Form des Korsakow-Syndroms litt und
infolgedessen praktisch alle kurz- und mittelfristige Merkfähigkeit
eingebüßt hatte, ihr musikalisches Gedächtnis ausgenommen.
edächtnis
In einem kleinen Kurort in der Nähe der majestätischen Iguaçufälle
im sogenannten mesopotamischen Gebiet an der Grenze zwischen
Argentinien, Brasilien und Paraguay erholte sich der große
zeitgenössische amerikanische Neurophysiologe Geoffrey
Sonnabend von schwerer körperlicher Erschöpfung und einer
Art Nervenzusammenbruch (zum Teil Folge des Scheiterns seiner
früheren Untersuchungen über die Gedächtnisbahnen bei Karpfen).
Am Abend hatte er ein Konzert der großen rumänisch-amerikanischen
Sängerin Madalena Delani besucht, die Lieder der deutschen Romantik
vortrug. Die Delani, damals eine der führenden Solistinnen auf
internationalen Gastspielen, hatte wiederholt Lob von Fachleuten
wie dem Musikkritiker der New York Times, Sidney Soledon, geerntet.
Dieser äußerte die Vermutung, das unvergleichlich schwermütige
Timbre ihrer Stimme - er nannte sie »durchtränkt von einem Gefühl
der Verlorenheit« - sei möglicherweise darauf zurückzuführen,
daß die Sängerin an einer Form des Korsakow-Syndroms litt und
infolgedessen praktisch alle kurz- und mittelfristige Merkfähigkeit
eingebüßt hatte, ihr musikalisches Gedächtnis ausgenommen.
Geoffrey verließ an diesem Abend zwar den Konzertsaal, ohne
der Delani auch nur vorgestellt worden zu sein, aber der Liedervortrag
hatte ihn elektrisiert, und in der folgenden schlaflosen Nacht
entwarf er wie in einem Rausch das gesamte
Modell der Überschneidung von Ebene und Kegel, das die Grundlage
für seine radikale neue Gedächtnistheorie bilden sollte, die
er während der nächsten zehn Jahre für sein dreibändiges Werk
Obliscence: Theories of Forgetting and the Problem of Matter
(Northwestern University Press, Chicago 1946) mit größter
Sorgfalt ausarbeitete. In Sonnabends Augen war das Gedächtnis
eine Illusion. Das Vergessen, nicht
das Erinnern, war das zwangsläufige
Ergebnis allen Erlebens. In der Einleitung zu seinem pompösen
Meisterwerk erklärte er demgemäß: »Wir, die wir allesamt mit
Amnesie geschlagen und dazu verurteilt sind, in einer ewig flüchtigen
Gegenwart zu leben, sind Schöpfer der aufwendigsten menschlichen
Konstruktion, nämlich des Gedächtnisses, das uns gegen das unerträgliche
Bewußtsein von der Unwiderruflichkeit des Zeitflusses und von
der Unwiederbringlichkeit zeitlicher Augenblicke und Ereignisse
abschirmen soll«. Diese Überzeugung führte er im folgenden
weiter aus, indem er ein immer komplizierteres Modell entwickelte,
bei dem ein sogenannter Kegel des Vergessens von Ebenen der Erfahrung
durchschnitten wird, die ihn mit unterschiedlichen, aber genau
bestimmbaren Neigungswinkeln zerteilen. Ihren größten Reiz entfaltete
die Theorie vielleicht dort, wo sie so unheimliche, zwielichtige
Phänomene wie Vorahnungen, Dejá-vu-Erlebnisse und Prophezeiungen
aufgriff. Sobald aber die Ebene eines bestimmten Erlebnisses
den Kegel passiert hatte, war das Erlebnis unwiederbringlich
vergessen - und alles andere war Illusion.
Als melancholische Pointe dieser Schlußfolgerung mag gelten,
daß Sonnabend - und mit ihm sein Opus magnum, kaum daß es erschienen
war - fast gänzlich dem Vergessen anheimfiel.
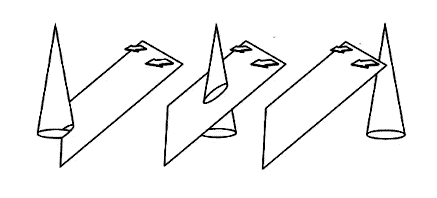
Ebene der Erfahrung, den Kegel des Vergessens
durchschneidend
- (wesch)
Gedächtnis (2) William James, um
zu zeigen, daß Denken ohne Sprechen
möglich ist, zitiert die Erinnerung eines Taubstummen, Mr. Ballard,
welcher schreibt, er habe in seiner frühen Jugend, noch ehe er
sprechen konnte, sich über Gott und die
Welt Gedanken
gemacht. - Was das wohl heißen mag! - Ballard schreibt: »It was
during those delightfül rides, some two or three years before
my initiation into the rudiments or written language, that I
began to ask myself the question: how came the world into being?«
— Bist du sicher, daß dies die richtige Übersetzung
deiner wortlosen Gedanken in Worte ist? - möchte man fragen.
Und warum reckt diese Frage — die doch sonst gar nicht zu existieren
scheint - hier ihren Kopf hervor? Will ich sagen, es täusche
den Schreiber sein Gedächtnis? — Ich weiß nicht einmal, ob ich
das sagen würde. Diese Erinnerungen
sind ein seltsames Gedächtnisphänomen — und ich weiß nicht, welche
Schlüsse auf die Vergangenheit des
Erzählers man aus ihnen ziehen kann! - (wit)
Gedächtnis (3) Dann
begann die allmähliche Umformung meiner Träume. Mir wurden keine
prächtigen Alpträume zuteil wie De Quincey, noch fromme
allegorische Visionen nach Art seines Meisters Jean Paul.
Unbekannte Gesichter und Räume drangen in meine Nächte. Das erste
Gesicht, das ich identifizierte, war das von Chapman; später
das von Ben Jonson und das eines Nachbarn des Dichters, der in
den Biographien nicht erwähnt wird, mit dem Shakespeare
aber oft verkehrte.
Wer eine Enzyklopädie erwirbt,
erwirbt nicht jede Zeile, jeden Abschnitt, jede Seite und jeden
Strich; er erwirbt die bloße Möglichkeit, das eine oder andere
davon kennenzulernen. Wenn dies schon bei einem konkreten und,
dank der alphabetischen Abfolge der Teile, relativ einfachen
Gegenstand so ist, wie soll es da mit einem abstrakten und variablen
Wesen sein, ondoyant et divers, wie dem magischen Gedächtnis
eines Toten?
Niemandem ist es gegeben, in einem einzigen Moment die Fülle
seiner Vergangenheit zu erfassen. Weder
Shakespeare, soweit ich weiß,
noch mir, der ich sein Teil-Erbe war, wurde diese Gabe gewährt.
Augustinus
spricht, wenn ich mich nicht irre, von den Palästen
und Höhlen der Erinnerung. Die zweite
Metapher ist treffender. In diese Höhlen drang ich ein.
Wie unseres umfaßte Shakespeares Gedächtnis Zonen,
große Zonen des Schattens, von ihm
absichtlich verdrängt. Nicht ohne gewisse Empörung erinnerte
ich mich, daß Ben Jonson ihn lateinische und griechische
Hexameter rezitieren ließ und daß sich das Gehör,
Shakespeares unvergleichliches Ohr, oft bei einer Quantität
irrte, unter dem Hohngelächter der Kollegen.
Ich erfuhr Zustände von Glück und
Schatten, die die gewöhnliche Erfahrung des Menschen überschritten.
Ohne daß ich es gewußt hätte, hatte mich die lange, lernbeflissene
Einsamkeit vorbereitet, das Wunder gierig aufzunehmen.
Nach etwa dreißig Tagen belebte mich das Gedächtnis des Toten.
Eine ganze Woche voll seltsamer Seligkeit glaubte ich beinahe,
Shakespeare zu sein. Das Werk erneuerte sich für mich.
Ich weiß, daß für Shakespeare der Mond
weniger der Mond war als Diana, und weniger Diana als jenes dunkle,
weilende Wort moon. Ich notiere eine weitere Entdeckung.
Shakespeares scheinbare Nachlässigkeiten, jene absences dans
l'infini, von denen Hugo entschuldigend spricht, waren
beabsichtigt. Shakespeare nahm sie hin. - Jorge
Luis Borges, Shakespeares Gedächtnis. In: Spiegel und Maske.
Erzählungen 1970 bis 1983. Frankfurt am Main 2000 (Fischer Tb.
10589).
Gedächtnis (4) Eines Nachts wurden alle Gehirne
träge und schwerfällig und am nächsten Morgen wachte ein jeder auf, ohne
sich auch nur im geringsten an das Vergangene zu erinnern. Einige Dikasterier,
die neben ihren Frauen schliefen, wollten sich diesen aus einem vom Gedächtnis
unabhängigen Rest von Naturtrieb nähern. Die Frauen, die nur sehr selten aus
natürlichem Instinkt ihre Ehemänner umarmen, wiesen die widerlichen Zärtlichkeiten
erbittert zurück. Die Ehemänner wurden böse, die Frauen schrien und weinten,
und in den meisten Familien prügelte man sich.
Als den Herren ihr Barett in die Hand fiel, bedienten sie sich seiner für
bestimmte Bedürfnisse, die weder das Gedächtnis noch der Verstand regeln, und
die Damen benutzten die Näpfe und Flakons ihrer Toilettentische
für die gleichen Zwecke. Die Dienstboten entsannen sich nicht mehr des Vertrags,
den sie mit ihren Herren geschlossen hatten, und betraten deren Zimmer, ohne
zu wissen, wo sie waren. Da der Mensch von Natur jedoch neugierig ist, öffneten
sie alle Schubladen, und da der Mensch natürlicherweise den Glanz des Silbers
und des Goldes liebt, ohne daß er dazu des Gedächtnisses bedürfe, nahmen sie
sich alles, was ihnen unter die Finger kam. Ihre Herren wollten rufen: »Haltet
den Dieb!« Doch da ihren Hirnen der Begriff für »Dieb«
entfallen war, kamen sie nicht auf das Wort. Ein jeder hatte seine Sprache vergessen
und stammelte unartikulierte Laute, so daß es viel schlimmer zuging als in Babel,
wo jeder augenblicklich eine neue Sprache erfand. Die jungen Dienern angeborene
und ihnen eigene Neigung zu hübschen Weibern regte sich
so heftig, daß diese Unverschämten sich blindlings auf die ersten besten Frauen
oder Mädchen stürzten, ob es nun Kellnerinnen oder Präsidentinnen waren; und
da sich diese nicht mehr an ihre Gebote der Sittsamkeit erinnerten, ließen sie
die Männer frei gewähren.
Sie mußten auch essen, doch wußte keiner mehr, wie man das anstellt; niemand
war auf dem Markt gewesen, um etwas zu verkaufen oder um zu kaufen. Die
Diener hatten die Kleider der Herren angezogen und die Herren die der
Diener. Alle glotzten sich stumpfsinnig an. Diejenigen, die findiger
waren und sich das Notwendigste zu verschaffen wußten - und das waren
die Leute aus dem Volk -, trieben etwas auf, wovon sie leben konnten;
den anderen aber mangelte es an allem. Der erste Präsident
und der Erzbischof liefen völlig nackt herum,
und ihre Stallknechte trugen entweder rote Roben oder Dalmatiken, liturgische
Gewänder. - (vol2)
Gedächtnis (5) Feindliches Gedächtnis. Der Geist verliert sich in der Erinnerung nicht aussprechbarer Wörter, zu weit entfernt vom Herzen.
Er nimmt das alte Buch wieder zur Hand, entdeckt die erwünschte Präsenz. Horridas nostrae mentis purga tenebras. *
Freundschaftliches Gedächtnis. Die kostbare Substanz, die es von
ihren Schlacken zu reinigen gilt, liegt im Chaos der ursprünglichen
Rede, dieses anonymen Tumults. Er hatte sich zu seinem Sprecher gemacht
ohne sich darum zu bemühen, auch nur einen einzigen versunkenen Ton
hören zu lassen. Die zu leistende Anstrengung erscheint übermäßig,
Accende lumen sensibus, **
* Reinige die schrecklichen Finsternisse unseres Geistes
** Entzünde ein Licht unseren Sinnen
- Robert Pinget, Der Feind. Berlin 1988
 edächtnis
In einem kleinen Kurort in der Nähe der majestätischen Iguaçufälle
im sogenannten mesopotamischen Gebiet an der Grenze zwischen
Argentinien, Brasilien und Paraguay erholte sich der große
zeitgenössische amerikanische Neurophysiologe Geoffrey
Sonnabend von schwerer körperlicher Erschöpfung und einer
Art Nervenzusammenbruch (zum Teil Folge des Scheiterns seiner
früheren Untersuchungen über die Gedächtnisbahnen bei Karpfen).
Am Abend hatte er ein Konzert der großen rumänisch-amerikanischen
Sängerin Madalena Delani besucht, die Lieder der deutschen Romantik
vortrug. Die Delani, damals eine der führenden Solistinnen auf
internationalen Gastspielen, hatte wiederholt Lob von Fachleuten
wie dem Musikkritiker der New York Times, Sidney Soledon, geerntet.
Dieser äußerte die Vermutung, das unvergleichlich schwermütige
Timbre ihrer Stimme - er nannte sie »durchtränkt von einem Gefühl
der Verlorenheit« - sei möglicherweise darauf zurückzuführen,
daß die Sängerin an einer Form des Korsakow-Syndroms litt und
infolgedessen praktisch alle kurz- und mittelfristige Merkfähigkeit
eingebüßt hatte, ihr musikalisches Gedächtnis ausgenommen.
edächtnis
In einem kleinen Kurort in der Nähe der majestätischen Iguaçufälle
im sogenannten mesopotamischen Gebiet an der Grenze zwischen
Argentinien, Brasilien und Paraguay erholte sich der große
zeitgenössische amerikanische Neurophysiologe Geoffrey
Sonnabend von schwerer körperlicher Erschöpfung und einer
Art Nervenzusammenbruch (zum Teil Folge des Scheiterns seiner
früheren Untersuchungen über die Gedächtnisbahnen bei Karpfen).
Am Abend hatte er ein Konzert der großen rumänisch-amerikanischen
Sängerin Madalena Delani besucht, die Lieder der deutschen Romantik
vortrug. Die Delani, damals eine der führenden Solistinnen auf
internationalen Gastspielen, hatte wiederholt Lob von Fachleuten
wie dem Musikkritiker der New York Times, Sidney Soledon, geerntet.
Dieser äußerte die Vermutung, das unvergleichlich schwermütige
Timbre ihrer Stimme - er nannte sie »durchtränkt von einem Gefühl
der Verlorenheit« - sei möglicherweise darauf zurückzuführen,
daß die Sängerin an einer Form des Korsakow-Syndroms litt und
infolgedessen praktisch alle kurz- und mittelfristige Merkfähigkeit
eingebüßt hatte, ihr musikalisches Gedächtnis ausgenommen.