









![]()
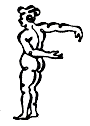 urcht Ich bin (wie sie
sagen) kein sonderlicher Naturgelehrter und weiß wenig davon,
durch welche Triebkräfte die Furcht in uns wirkt; aber so viel
steht fest, daß es eine seltsame Leidenschaft ist: und die Ärzte
sagen, daß es keine andere gibt, die unsere Vernunft heftiger
aus ihrer geziemenden Fassung wirft. Wirklich habe ich viele
Leute aus Furcht toll werden sehen; und es ist gewiß, daß sie
bei den Besonnensten, solange ihre Anwandlung währt, fürchterliche
Verblendungen hervorbringt. Ich lasse das gemeine Volk beiseite,
dem sie bald die Urahnen aus den Gräbern erstanden vorstellt,
in ihre Leichentücher gehüllt, bald Werwölfe, Kobolde und Fabeltiere.
Doch selbst bei Kriegsleuten, unter denen sie weniger hausen
sollte, wie oft hat sie da eine Herde Schafe in eine Schwadron
Gewaffneter verwandelt? Schilf und Röhricht in Spieß — und Lanzenträger?
unsere Freunde in unsere Feinde? und das weiße Kreuz in das rote?
urcht Ich bin (wie sie
sagen) kein sonderlicher Naturgelehrter und weiß wenig davon,
durch welche Triebkräfte die Furcht in uns wirkt; aber so viel
steht fest, daß es eine seltsame Leidenschaft ist: und die Ärzte
sagen, daß es keine andere gibt, die unsere Vernunft heftiger
aus ihrer geziemenden Fassung wirft. Wirklich habe ich viele
Leute aus Furcht toll werden sehen; und es ist gewiß, daß sie
bei den Besonnensten, solange ihre Anwandlung währt, fürchterliche
Verblendungen hervorbringt. Ich lasse das gemeine Volk beiseite,
dem sie bald die Urahnen aus den Gräbern erstanden vorstellt,
in ihre Leichentücher gehüllt, bald Werwölfe, Kobolde und Fabeltiere.
Doch selbst bei Kriegsleuten, unter denen sie weniger hausen
sollte, wie oft hat sie da eine Herde Schafe in eine Schwadron
Gewaffneter verwandelt? Schilf und Röhricht in Spieß — und Lanzenträger?
unsere Freunde in unsere Feinde? und das weiße Kreuz in das rote?
Eine ähnliche Furcht packt zuweilen eine ganze Menge. Bei einem der Gefechte des Germanicus gegen die Alemannier ergriffen zwei große Haufen vor Schrecken zwei entgegengesetzte Wege, und der eine floh dahin, wo der andere herkam.
Zuweilen beflügelt sie unsre Fersen; zuweilen lähmt sie unsere Füße und nagelt uns fest, wie man von Kaiser Theophil liest, der in einer Schlacht, die er gegen die Agarener verlor, so bestürzt und betäubt war, daß er nicht einmal den Entschluß zur Flucht zu fassen vermochte: adeo pavor etiam auxilia formidat, bis Manuel, einer der ersten Hauptleute seines Heeres, ihn zerrte und schüttelte, wie um ihn aus einem tiefen Schlaf aufzuwecken, und ihm sagte: Wenn Ihr mir nicht folgt, so werde ich Euch töten, denn es ist besser, Ihr verliert das Leben, als daß durch Eure Gefangennahme das Reich verlorengehe.
Dann erweist sie ihre äußerste Kraft, wenn sie in ihrer Botmäßigkeit wieder zu jener Tapferkeit antreibt, deren sie unser Pflichtbewußtsein und unser Ehrgefühl beraubt hat. In der ersten genauen Schlacht, welche die Römer unter dem Konsul Sempronius gegen Hannibal verloren, wurde ein Trupp von wohl zehntausend Fußsoldaten vom Entsetzen ergriffen, und da er nirgends sonst einen Ausweg für seine Verzagtheit fand, warf er sich mitten in den Gewalthaufen des Feindes, durch den er sich mit bewundernswertem Ungestüm Bahn brach und ein großes Blutbad unter den Karthagern anrichtete, und erkaufte sich so eine schimpfliche Flucht um denselben Preis, um den er einen ruhmvollen Sieg errungen hätte.
Wovor ich mich am meisten fürchte, ist die Furcht. -
(mon)
- Stoiker, nach
(diol)
Furcht (3) Die Furcht löst im Menschen viele
beklagenswerte Reaktionen aus, wie Erröten und Erblassen,
Zittern und Schweißausbrüche. Ihren Opfern wird abwechselnd heiß und kalt, ihr
Herz klopft im Halse, oder sie werden ohnmächtig. Oft überfällt sie Menschen,
die etwa bei einer Volksversammlung auftreten und eine Rede halten sollen oder
die vor bedeutende Persönlichkeiten zitiert worden sind, und selbst Cicero
gestand ein, daß er vor Redebeginn immer noch ins Zittern gerate, was übrigens
auch für den großen griechischen Redner Demosthenes galt. Die Furcht verschlägt
die Stimme und raubt das Gedächtnis. Also läßt Lukian seinen Jupiter
Tragoedus bei einer Ansprache sinnigerweise so viel Angst vor seiner göttlichen
Zuhörerschaft haben, daß er kein vernünftiges Wort mehr hervorbringt, sondern
sich notgedrungen von Merkur soufflieren lassen muß. Vielen Menschen setzt die
Furcht dermaßen zu, daß sie nicht mehr wissen, wo sie sich befinden, was sie
sagen und was sie tun. Noch schlimmer aber ist die Tatsache, daß sie sie schon
viele Tage vor dem Ereignis auf die Folter ihrer Ängste und bösen Vorahnungen
spannt. Furcht verhindert die ehrenwertesten Unternehmungen, läßt das Herz schwer
werden und macht traurig und niedergeschlagen. Die Furchtsamen sind nicht frei,
entschlossen, sicher, nie fröhlich, nie ohne Schmerz; deshalb trifft Vives'
Bemerkung zu, es gebe kein größeres Elend, keine schlimmere Marter. Ewig argwöhnisch,
ängstlich, besorgt neigen die Betroffenen zu grundloser und kindischer Kopfhängerei
und büßen nach Plutarch angesichts des Schrecklichen ihr Urteilsvermögen
ein. Oft ist plötzlicher Irrsinn die Folge. - (bur)
Furcht (4) Die Liebe
vertreibt die Furcht, aber umgekehrt vertreibt auch die Furcht die
Liebe. Und nicht nur die Liebe. Die Furcht vertreibt auch den Verstand,
die Güte und jeden Gedanken an Schönheit und Wahrheit. Was bleibt, ist
eine dumpfe oder auch angestrengt witzige Verzweiflung. Die Verzweiflung
eines Menschen, der in einer Ecke seines Zimmers etwas Unheimliches
bemerkt und der weiß, daß die Tür verschlossen ist und der Raum keine
Fenster hat. Und jetzt dringt es auf ihn ein. Er fühlt eine Hand auf
seinem Arm, er riecht einen stinkenden Atem, als der Gehilfe des Henkers
sich fast verliebt über ihn neigt. »Du bist dran, Bruder. Sei so gut
und komm hier entlang!« In diesem Augenblick wird aus seinem stillen
Grauen eine ebenso wilde wie vergebliche Raserei. Hier ist nicht mehr
ein Mensch unter Mitmenschen, kein rationales Wesen mehr, das sich auf
artikulierte Weise mit anderen rationalen Wesen unterhält, sondern nur
ein gequältes Tier in der Falle, in der es schreit und zappelt. Denn
zuletzt vertreibt die Furcht auch das Menschsein des Menschen.
Aber die Furcht, meine Freunde, ist der Ursprung und die Basis des
modernen Lebens überhaupt. Furcht vor der vielgepriesenen Technik, die
zwar unseren Lebensstandard hebt, aber auch unseren gewaltsamen Tod sehr
viel wahrscheinlicher macht. Furcht vor der Wissenschaft, die mit der
einen Hand uns mehr nimmt, als sie mit der anderen verschwenderisch
schenkt. Furcht vor den nachweislich verhängnisvollen Institutionen, für
die wir in selbstmörderischer Treue bereit sind zu töten und zu
sterben. Furcht vor den großen Männern, denen wir durch allgemeine
Zustimmung eine Macht verliehen haben, die sie zwangsläufig dazu
ausnutzen, uns zu versklaven und zu morden. Die Furcht schließlich vor
dem Krieg, den wir nicht wollen und den herbeizuführen wir doch alles
tun, was in unseren Kräften steht.
- Aldous Huxley, Affe und Wesen. München 1988 (zuerst 1949)
 |
||
 |
||
 |
 |
|
 |
||
|
|
 |
|
  |
  |
|
|
|
||