









![]()
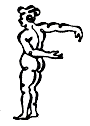 reiheit
Frei lebt, wer sterben
kann.
reiheit
Frei lebt, wer sterben
kann. - (blix,
nach Seneca u.v.a.)Freiheit (2) Wir können nur die
Tiere frei nennen, die die Gefangenschaft nicht ertragen, bei denen gefangen
werden und durch den Tod entschlüpfen eins sind. So sagt auch Diogenes
einmal, daß es einen Weg zur Freiheit gibt: »gelassen zu sterben«, und
dem Perserkönig schreibt er: »Die Stadt der Athener kannst du nicht knechten,
sowenig wie die Fische.« — »Wieso? Kann ich sie nicht in meine Gewalt bringen?«
— »Wenn du das tust, werden sie dir alsbald entwischen wie die Fische.
Stirbt doch auch jeder Fisch, den du fängst. Und wenn nun die Athener,
von dir gefangen, ebenfalls sterben, was nützt dir dann dein ganzes Unternehmen?«
— Das ist das Wort eines freien Mannes, der der Sache auf den Grund gegangen
ist. - Epiktet
Freiheit (3) Heiraten ist in Paris
keine leichte Angelegenheit, vor allem nicht für einen Mann mittleren Alters
und mittlerer Verhaltnisse. Ganz abgesehen von der Unabhängigkeit, auf
die alle Frauen Anspruch erheben, kostet es eine Unmenge, eine Frau zu
unterhalten und für alle Bedürf nisse und Einfälle, die die Mode täglich
liefert, aufzukommen. Diejenigen; die nicht reich genug oder zu sparsam
sind oder sich ihre Freiheit bewahren wollen, nehmen eine Haushälterin,
das heißt eine Konkubine, die nicht oder nur selten in Erscheinung tritt
und, da sie auf die Hausarbeit beschränkt ist,
Sorge trägt für die Mahlzeiten und den Haushalt und mit dem Herrn ißt,
wenn er allein ist. - (merc)
Freiheit (4) Welche Transformierbarkeit
besitzt das Unsere, das Angerichtete noch? Allem Anschein nach keine mehr.
Wir sind in die Beständigkeit des sich selbst korrigierenden System eingelaufen.
Ob das noch Demokratie ist oder schon Demokratismus: ein kybernetisches
Modell, ein wissenschaftlicher Diskurs, ein politisch-technischer Seibstüberwachungsverein,
bleibe dahin gestellt. Sicher ist, dieses Gebilde braucht immer wieder,
wie ein physischer Organismus, den inneren und äußeren Druck von Gefahren,
Risiken, sogar eine Periode von ernsthafter Schwächung, um seine Kräfte
neu zu sammeln, die dazu tendieren, sich an tausenderlei Sekundäres zu
verlieren. Es ist bislang konkurrenzlos, weder Totalitarismus noch Theokratie
brächten etwas Besseres zum Wohl der größtmöglichen Zahl zustande als dieses
System der abgezweckten Freiheiten.
Natürlich gilt das nur solange, als wir davon überzeugt sind, daß allein
der ökonomische Erfolg die Massen formt, bindet und erhellt. Nach Lage
der Dinge dämmert es manchem inzwischen, daß Gesellschaften, bei denen
der Ökonomismus nicht im Zentrum aller Antriebe steht, aufgrund ihrer geregelten
glaubensgestützten Bedürfnisbeschränkung
im Konfliktfall eine beachtliche Stärke oder gar Überlegenheit zeigen werden.
Wenn wir Reichen nur um minimale Prozente an Reichtum verlieren, so zeitigt
das in unserem reizbaren, nervösen System nicht nur innenpolitische Folgen,
sondern vor allem abrupte Folgen der politischen Innerlichkeit, den impulsiven
Ausbruch von Unduldsamkeit und Aggression. - Botho Strauß, Anschwellender
Bocksgesang, in: Der Pfahl VII, 1993
Freiheit (5) Einzig das Wort Freiheit
vermag mich noch zu begeistern. Ich halte es für geeignet, die alte Flamme,
den Fanatismus des Menschen für alle Zeiten zu
erhalten. Ohne Zweifel entspricht es meinem einzigen legitimen Wunsch.
Unter so viel ererbter Ungnade bleibt uns, wie man zugeben muß, die größte
Freiheit, die des Geistes, doch gewährt. Es liegt an uns, sie nicht
leichtfertig zu vertun. Zuzulassen, daß die Imagination versklavt wird
auch wenn es um das ginge, was man so leichthin das Glück
nennt — das hieße, sich allem entziehen, was man in der Tiefe seiner selbst
an höchster Gerechtigkeit findet.
Einzig die Imagination zeigt mir, was sein
kann und das genügt, den furchtbaren Bann ein wenig zu lösen; genügt
auch, mich ihr ohne Furcht, mich zu täuschen, zu ergeben (als wenn man
sich noch mehr täuschen könnte). Wo beginnt sie, Trug
zu werden, und wo ist der Geist nicht mehr zuverlässig? Ist für den Geist
die Möglichkeit, sich zu irren, nicht vielmehr die Zufälligkeit,
richtig zu denken? - André Breton, Erstes Manifest des Surrealismus
(1924)
Freiheit (6) Annabelle wußte, daß
sie an der Tür klingeln und Michel sehen konnte; aber sie konnte es auch lassen.
Sie war sich nicht recht bewußt, daß sie in diesem Augenblick die konkrete Erfahrung
der Freiheit machte; auf jeden Fall war es ganz furchtbar, und nach diesen zehn
Minuten sollte sie nie mehr ganz dieselbe sein. Viele Jahre später sollte Michel
eine kurze Theorie der menschlichen Freiheit vorstellen, die auf der Analogie
mit dem Verhalten des supraflüssigen Heliums beruhte. Das diskrete atomare Phänomen
des Elektronenaustauschs zwischen den Neuronen und den Synapsen im Inneren des
Gehirns ist im Prinzip der Quantenunschärfe unterworfen; die große Anzahl der
Neuronen bewirkt jedoch durch die statistisch bedingte Aufhebung der elementaren
Unterschiede, daß das menschliche Verhalten -sowohl in seinen groben Zügen wie
auch in den Einzelheiten -ebenso streng determiniert ist wie das jedes anderen
natürlichen Systems. Doch unter manchen, äußerst
seltenen Umständen -die Christen nannten es das Wirken der Gnade
- entsteht eine neue Kohärenzwelle und breitet sich im Inneren des Gehirns
aus; dadurch läßt sich - vorübergehend oder endgültig - ein neues Verhalten
beobachten, das durch ein völlig anderes System harmonischer Oszillatoren bestimmt
wird; es handelt sich um etwas, das man gemeinhin eine freie Handlung
nennt. - Michel Houellebecq,
Elementarteilchen. München 2001 (zuerst 1998)
Freiheit (7) Er wußte nicht,
wohin er fuhr, noch was er tun würde. Er hatte sich auf den Weg gemacht. Er
hatte nichts hinter sich gelassen und hatte auch noch nichts vor sich. Er war
frei.
Er hatte Hunger. Alle aßen. Auf einem Bahnhof kaufte er sich belegte
Brötchen und eine Flasche Bier.
In Lyon war es schon dunkel. Er wäre fast ausgestiegen, ohne zu wissen warum,
versucht, sich schon in das von Lichtern gesprenkelte Dunkel zu stürzen, aber
der Zug fuhr weiter, ehe er noch die Zeit gehabt hatte, sich zu entscheiden.
Es gab vieles in ihm, das er später ins reine bringen mußte, später, wenn er
sich eingewöhnt hatte, wenn der Zug am Ziel sein, wenn er endlich irgendwo ankommen
würde. - Georges Simenon, Die Flucht des Herrn Monde. Köln 1970 (zuerst
1952)
Freiheit (8) Frei sein und durch
sich selbst bestimmt sein, von innen heraus bestimmt sein, ist eins. -
Friedrich Schiller, Kallias-Briefe
Freiheit (9) Eines Abends kam
ich in die Stube und Ruth war nackt. Sie wusch sich. Da erlebte ich in meinem
Körper zum erstenmal Freiheit, denn ich bekam einen Steifen.
Heftig liebte ich Ruth in diesem Augenblick, heftig begehrte ich sie. Autonom.
Ihr von Wilm genossenes Liebesfleisch erregte mich, Ruths Schönheit bewegte
mich und ihre erotische Reinheit überzeugte mich von der Weisheit meiner Wahl.
Das alles geschah gleichzeitig und das war nun auch Wirklichkeit, ich fühlte
Zuversicht, als ich den Steifen hatte, denn in meiner Geilheit wurde ich bewußter.
- (kap)
Freiheit (10) Dasjenige
wird frei zu nennen sein, das aus der bloßen Notwendigkeit seiner Natur existiert
und nur durch sich selbst zum Handeln bestimmt wird.
- Spinoza, nach: Schopenhauer, Über
den Willen in der Natur. Zürich 1977
Freiheit (11)
|
LA LIBERTÉ Elle est venue par cette ligne blanche pouvant tout aussi bien signifier l'issue de l'aube que le bougeoir du crépuscule.
Son verbe ne fut pas un aveugle bélier mais la toile où s'inscrivit mon souffle. D'un pas à ne se mal guider que derrière l'absence, eile est venue, cygne sur la blessure, par cette ligne blanche. |
DIE FREIHEIT Sie ist auf diesem weißen Streifen gekommen, der genausogut das Ende der Morgendämmerung bedeuten kann wie den Leuchter des Zwielichts am Abend. Sie schritt über die willenlosen Küsten; sie schritt über die ausgeweideten Gipfel. Ein Ende nahm die Entsagung mit Feiglingsgesicht, die Heiligkeit der Lüge, der Alkohol des Henkers. Ihr Wort war kein blinder Widder, sondern das Segel, wo mein Atem sich eintrug. Mit einem Schritt, der nur in die Irre geht, wenn er dem Nichtvorhandenen folgt, ist sie gekommen, Schwan über der Wunde, auf diesem weißen Streifen. |
- René Char, Zorn und Geheimnis. Frankfurt am Main 1991
(zuerst 1948)
Freiheit (12) »Jedesmal,
wenn sich Differenzen infolge von Spannungen zeigen und ein Gefühl der Frustration
aufleben lassen, somit auch eine Reaktion heraufbeschwören, ist anzunehmen,
daß auch am Markt ein entsprechendes Produkt auftaucht, das die Spannung auflöst
und die Aspirationen der Gruppe in geregelte Bahnen lenkt« (Ernest Dichter,
Strategie der Wünsche). Die Aufgabe liegt also darin, den bis dahin durch
mentale Instanzen gehemmten Triebansprüchen (Tabus, Über-Ich, Schuldgefühl)
einen Ausweg zu sichern, damit sie sich an den Objekten erfüllen können, womit
die explosive Kraft der Wünsche entschärft und die repressive Funktion der sozialen
Ordnung verschärft wird. Die Freiheit des Seins ist immer gefährlich, wenn das
Individuum in ihrem Namen sich gegen die Gesellschaft erhebt. Die Freiheit des
Habens dagegen ist eine harmlose, denn sie fügt sich, ohne sich dessen recht
bewußt zu sein, in die Gesamtstruktur ein. Diese Art der Freiheit, sagt Dichter,
ist moralisch, ist sogar die Moral der Moral, da der Verbraucher zugleich mit
sich selbst und mit der Gruppe versöhnt wird. So wird er zum vollkommenen sozialen
Wesen. Die traditionelle Moral hat dem einzelnen die Verpflichtung auferlegt,
sich mit der Gruppe auszugleichen. Die »philosophische« Werbung verlangt nun
von ihm, auch mit sich selbst konform zu sein und die eigenen Konflikte zu lösen.
Sie schenkt ihm ein moralisches Vertrauen, wie er es in diesem Ausmaß früher
nie genossen hat. Die Tabus, Beklemmungen und Neurosen, die den Menschen zum
Sonderling und Vogelfreien machten, werden durch eine das Gefühl der Geborgenheit
gewährende Regression ausgeschaltet. Eine immer freiere Irrationalität der Begierden
an der Basis des Gebäudes geht Hand in Hand mit der immer strenger gehandhabten
Kontrolle an der Spitze. - (baud)

|
||
 |
||
 |
 |
|

|
||
  |
  |
|
|
|
||