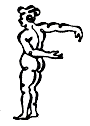 lüssigkeit Wer
Pflanzen sät, muß fleißig gießen. Wer ein Haus baut, muß reichlich Zinsen zahlen.
Wer eine Sache bereinigt, muß tüchtig schwitzen. Zum Gießen gehört Wasser,
zum Zahlen gehört Geld, zum Schwitzen gehört Schweiß. Wenn Wasser in Strömen
fließt, dann ist gut gießen. Wenn Geld in Strömen fließt, dann ist gut zahlen.
Wenn Schweiß in Strömen fließt, dann ist gut schwitzen. Je flüssiger das Wasser
ist, um so besser läßt sich gießen. Je flüssiger das Geld ist, um so besser
läßt sich zahlen. Je flüssiger der Schweiß ist, um so besser läßt sich schwitzen.
Wasser, Geld und Schweiß sind Flüssigkeiten. Suzanne gießt fleißig, weil sie
Pflanzen gesät hat. Monsieur Dupont zahlt reichlich, weil er ein Haus gebaut
hat. Hans und Grete schwitzen tüchtig, weil sie eine Sache bereinigen. Aber
Flüssigkeiten sind nicht ein für alle Male Flüssigkeiten. Wenn sie erstarren,
sind die Flüssigkeiten fest. Dann kann Suzanne nicht mehr gießen, weil sie kein
Wasser hat. Dann kann Monsieur Dupont nicht mehr zahlen, weil er kein Geld hat.
Dann können Hans und Grete nicht mehr schwitzen, weil sie keinen Schweiß haben.
Bei erstarrten Flüssigkeiten empfiehlt es sich nicht,
eine Sache zu bereinigen. Aber Flüssigkeiten sind nicht nur flüssig oder
fest. Wenn sie verdunsten, sind die Flüssigkeiten gasförmig. Auch dann kann
Suzanne nicht gießen, weil ihr Wasser nicht mehr flüssig ist. Auch dann kann
Monsieur Dupont nicht zahlen, weil sein Geld nicht mehr flüssig ist. Auch dann
können Hans und Grete nicht schwitzen, weil ihr Schweiß nicht mehr flüssig
ist. Verdunstete Flüssigkeiten sind wie erstarrte, sie fließen nicht. Und weil
nun aber zum Gießen Wasser, zum Zahlen Geld und zum Schwitzen Schweiß gehört,
kommt es darauf an, Wasser, Geld und Schweiß flüssig zu halten. Denn je flüssiger
das Wasser ist, um so haltbarer sind hernach die Pflanzen. Je flüssiger das
Geld ist, um so haltbarer ist hernach das Haus. Je flüssiger der Schweiß ist,
um so haltbarer ist hernach die bereinigte Sache. Je flüssiger, um so fester.
-
lüssigkeit Wer
Pflanzen sät, muß fleißig gießen. Wer ein Haus baut, muß reichlich Zinsen zahlen.
Wer eine Sache bereinigt, muß tüchtig schwitzen. Zum Gießen gehört Wasser,
zum Zahlen gehört Geld, zum Schwitzen gehört Schweiß. Wenn Wasser in Strömen
fließt, dann ist gut gießen. Wenn Geld in Strömen fließt, dann ist gut zahlen.
Wenn Schweiß in Strömen fließt, dann ist gut schwitzen. Je flüssiger das Wasser
ist, um so besser läßt sich gießen. Je flüssiger das Geld ist, um so besser
läßt sich zahlen. Je flüssiger der Schweiß ist, um so besser läßt sich schwitzen.
Wasser, Geld und Schweiß sind Flüssigkeiten. Suzanne gießt fleißig, weil sie
Pflanzen gesät hat. Monsieur Dupont zahlt reichlich, weil er ein Haus gebaut
hat. Hans und Grete schwitzen tüchtig, weil sie eine Sache bereinigen. Aber
Flüssigkeiten sind nicht ein für alle Male Flüssigkeiten. Wenn sie erstarren,
sind die Flüssigkeiten fest. Dann kann Suzanne nicht mehr gießen, weil sie kein
Wasser hat. Dann kann Monsieur Dupont nicht mehr zahlen, weil er kein Geld hat.
Dann können Hans und Grete nicht mehr schwitzen, weil sie keinen Schweiß haben.
Bei erstarrten Flüssigkeiten empfiehlt es sich nicht,
eine Sache zu bereinigen. Aber Flüssigkeiten sind nicht nur flüssig oder
fest. Wenn sie verdunsten, sind die Flüssigkeiten gasförmig. Auch dann kann
Suzanne nicht gießen, weil ihr Wasser nicht mehr flüssig ist. Auch dann kann
Monsieur Dupont nicht zahlen, weil sein Geld nicht mehr flüssig ist. Auch dann
können Hans und Grete nicht schwitzen, weil ihr Schweiß nicht mehr flüssig
ist. Verdunstete Flüssigkeiten sind wie erstarrte, sie fließen nicht. Und weil
nun aber zum Gießen Wasser, zum Zahlen Geld und zum Schwitzen Schweiß gehört,
kommt es darauf an, Wasser, Geld und Schweiß flüssig zu halten. Denn je flüssiger
das Wasser ist, um so haltbarer sind hernach die Pflanzen. Je flüssiger das
Geld ist, um so haltbarer ist hernach das Haus. Je flüssiger der Schweiß ist,
um so haltbarer ist hernach die bereinigte Sache. Je flüssiger, um so fester.
-
Aus: Ludwig Harig, Sprechstunden für die
deutsch-französische Verständigung und die Mitglieder des gemeinsamen
Marktes, ein Familienroman. - München 1974
(dtv sr 125 , zuerst Hanser 1971)
Flüssigkeit (2) Nach Balzac kann
«das Gefühl sich chemisch zu einem Fluidum
verdichten, welches ungefähr dem elektrischen Fluidum gleich ist». Bonnet,
Saint-Simon und andere hatten ein «Nervenfluidum» statuiert, welches die
Ursache aller Seelenvorgänge sein sollte. Damit ist dann gelegentlich die Theorie
von der kosmischen Polarität des Festen und des Flüssigen verbunden. Der Kampf
dieser beiden Elemente, «die immer in gleicher Menge im Weltall vorhanden sind»,
sollte nach Saint-Simon das kosmologische Grundphänomen sein. Man erkennt
darin Spekulationen wieder, die über die Renaissance bis nach Griechenland zurückgehen
und die auch in der deutschen Romantik die Gemüter fesselten.
«Wie wenige haben sich noch in die Geheimnisse des Flüssigen
vertieft», schreibt Novalis.« Die Berauschten fühlen nur zu gut diese
überirdische Wonne des Flüssigen, und am Ende sind alle angenehmen Empfindungen
in uns mannigfache Zerfließungen, Regungen jener Urgewässer in uns.» Derselbe
Novalis hat ja geschrieben: «Denken - auch Galvanismus.
Denken ist eine Muskelbewegung.» Das Phänomen des Flüssigen wird von Balzac
vielfach erörtert und hat auch in seinem Sprachgebrauch charakteristische Spuren
hinterlassen. Alle Leistungen des Menschen sind mit dem Verbrauch von Lebensflüssigkeiten
verknüpft. Der Wille ist «der König der Flüssigkeiten». Er ist übertragbar durch
Blick, Stimme, Gebärde
- Formen, in denen sich die Lebenskraft nach außen projiziert. Unter den magischen
Kräften steht solch magnetischer Wille an oberster Stelle. Er ist Schöpfer des
Lebens, aber er kann auch zerstören. Denn eine «rapide Konzentration» von Ideen,
Kräften, Gemütsbewegungen bewirkt in der Seele Bildung von Giften oder Säuren,
die plötzlich das Innere überschwemmen und dadurch den Menschen töten können.»
- Ernst Robert Curtius, Balzac.
Bern 1951
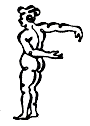 lüssigkeit Wer
Pflanzen sät, muß fleißig gießen. Wer ein Haus baut, muß reichlich Zinsen zahlen.
Wer eine Sache bereinigt, muß tüchtig schwitzen. Zum Gießen gehört Wasser,
zum Zahlen gehört Geld, zum Schwitzen gehört Schweiß. Wenn Wasser in Strömen
fließt, dann ist gut gießen. Wenn Geld in Strömen fließt, dann ist gut zahlen.
Wenn Schweiß in Strömen fließt, dann ist gut schwitzen. Je flüssiger das Wasser
ist, um so besser läßt sich gießen. Je flüssiger das Geld ist, um so besser
läßt sich zahlen. Je flüssiger der Schweiß ist, um so besser läßt sich schwitzen.
Wasser, Geld und Schweiß sind Flüssigkeiten. Suzanne gießt fleißig, weil sie
Pflanzen gesät hat. Monsieur Dupont zahlt reichlich, weil er ein Haus gebaut
hat. Hans und Grete schwitzen tüchtig, weil sie eine Sache bereinigen. Aber
Flüssigkeiten sind nicht ein für alle Male Flüssigkeiten. Wenn sie erstarren,
sind die Flüssigkeiten fest. Dann kann Suzanne nicht mehr gießen, weil sie kein
Wasser hat. Dann kann Monsieur Dupont nicht mehr zahlen, weil er kein Geld hat.
Dann können Hans und Grete nicht mehr schwitzen, weil sie keinen Schweiß haben.
Bei erstarrten Flüssigkeiten empfiehlt es sich nicht,
eine Sache zu bereinigen. Aber Flüssigkeiten sind nicht nur flüssig oder
fest. Wenn sie verdunsten, sind die Flüssigkeiten gasförmig. Auch dann kann
Suzanne nicht gießen, weil ihr Wasser nicht mehr flüssig ist. Auch dann kann
Monsieur Dupont nicht zahlen, weil sein Geld nicht mehr flüssig ist. Auch dann
können Hans und Grete nicht schwitzen, weil ihr Schweiß nicht mehr flüssig
ist. Verdunstete Flüssigkeiten sind wie erstarrte, sie fließen nicht. Und weil
nun aber zum Gießen Wasser, zum Zahlen Geld und zum Schwitzen Schweiß gehört,
kommt es darauf an, Wasser, Geld und Schweiß flüssig zu halten. Denn je flüssiger
das Wasser ist, um so haltbarer sind hernach die Pflanzen. Je flüssiger das
Geld ist, um so haltbarer ist hernach das Haus. Je flüssiger der Schweiß ist,
um so haltbarer ist hernach die bereinigte Sache. Je flüssiger, um so fester.
-
lüssigkeit Wer
Pflanzen sät, muß fleißig gießen. Wer ein Haus baut, muß reichlich Zinsen zahlen.
Wer eine Sache bereinigt, muß tüchtig schwitzen. Zum Gießen gehört Wasser,
zum Zahlen gehört Geld, zum Schwitzen gehört Schweiß. Wenn Wasser in Strömen
fließt, dann ist gut gießen. Wenn Geld in Strömen fließt, dann ist gut zahlen.
Wenn Schweiß in Strömen fließt, dann ist gut schwitzen. Je flüssiger das Wasser
ist, um so besser läßt sich gießen. Je flüssiger das Geld ist, um so besser
läßt sich zahlen. Je flüssiger der Schweiß ist, um so besser läßt sich schwitzen.
Wasser, Geld und Schweiß sind Flüssigkeiten. Suzanne gießt fleißig, weil sie
Pflanzen gesät hat. Monsieur Dupont zahlt reichlich, weil er ein Haus gebaut
hat. Hans und Grete schwitzen tüchtig, weil sie eine Sache bereinigen. Aber
Flüssigkeiten sind nicht ein für alle Male Flüssigkeiten. Wenn sie erstarren,
sind die Flüssigkeiten fest. Dann kann Suzanne nicht mehr gießen, weil sie kein
Wasser hat. Dann kann Monsieur Dupont nicht mehr zahlen, weil er kein Geld hat.
Dann können Hans und Grete nicht mehr schwitzen, weil sie keinen Schweiß haben.
Bei erstarrten Flüssigkeiten empfiehlt es sich nicht,
eine Sache zu bereinigen. Aber Flüssigkeiten sind nicht nur flüssig oder
fest. Wenn sie verdunsten, sind die Flüssigkeiten gasförmig. Auch dann kann
Suzanne nicht gießen, weil ihr Wasser nicht mehr flüssig ist. Auch dann kann
Monsieur Dupont nicht zahlen, weil sein Geld nicht mehr flüssig ist. Auch dann
können Hans und Grete nicht schwitzen, weil ihr Schweiß nicht mehr flüssig
ist. Verdunstete Flüssigkeiten sind wie erstarrte, sie fließen nicht. Und weil
nun aber zum Gießen Wasser, zum Zahlen Geld und zum Schwitzen Schweiß gehört,
kommt es darauf an, Wasser, Geld und Schweiß flüssig zu halten. Denn je flüssiger
das Wasser ist, um so haltbarer sind hernach die Pflanzen. Je flüssiger das
Geld ist, um so haltbarer ist hernach das Haus. Je flüssiger der Schweiß ist,
um so haltbarer ist hernach die bereinigte Sache. Je flüssiger, um so fester.
-










