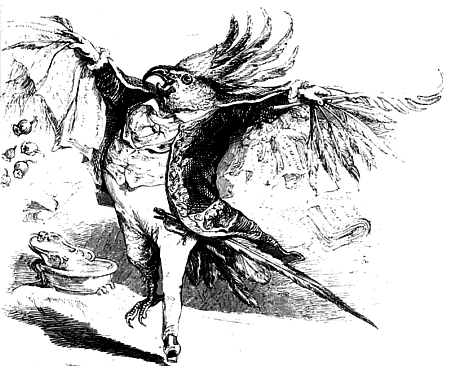
 ichter
Wortefinder, Gedankenmacher, Lebensmacher, Lebensdichtmacher,
Lebenstrombettabdichter, Schicksalsfüger, Lebensmeister, Lebenslenker, Vorausdenker,
Vorausleber, Zukunftskünder, Wahrheitsfinder, Wahrheitssprecher, Menschheitsmacher,
Staatsgewaltzerdenker, Volksbefreier (s. Phantasie, Kunst). Der richtige
Dichter ist der allerfreiesten denkende Mensch. Darum sind alle Richtigdichter
Staatsverneiner gewesen (s. Aristophanes, Plautus, Cervantes,
Shakespeare, Goethe, Heine, Reuter), deshalb wird
der wahre D. vom Volk geliebt und vom Staat gefürchtet. Die Falschdichter dagegen
gehören zu den Volksschindern und gehen daher am liebsten mit den Königen, andernfalls
schlagen sie sich zu den Verschwörern (s. Dante).
Der Richtigdichter wohnt nicht auf den eisigen Höhen der Übermenschen, wo die
Menschheit abstirbt, sondern in ihren Tiefen, wo die ewigen Lebens-, Denk- und
Sprachquellen rauschen. Der D., dem eine staatliche Anerkennung zuteil wird,
ist verdächtig, wenn er nicht, wie Goethe und Schiller, die sich den Adel
verliehen, über jeden Verdacht erhaben ist. Ein dichtender Mensch, der
sich zur guten, also zur blöden Gesellschaft zählt, ist ein Undichter (s. Unflat).
In der freien Menschheit wird jeder sein eigener Dichter und Schicksalsmacher
sein -
ichter
Wortefinder, Gedankenmacher, Lebensmacher, Lebensdichtmacher,
Lebenstrombettabdichter, Schicksalsfüger, Lebensmeister, Lebenslenker, Vorausdenker,
Vorausleber, Zukunftskünder, Wahrheitsfinder, Wahrheitssprecher, Menschheitsmacher,
Staatsgewaltzerdenker, Volksbefreier (s. Phantasie, Kunst). Der richtige
Dichter ist der allerfreiesten denkende Mensch. Darum sind alle Richtigdichter
Staatsverneiner gewesen (s. Aristophanes, Plautus, Cervantes,
Shakespeare, Goethe, Heine, Reuter), deshalb wird
der wahre D. vom Volk geliebt und vom Staat gefürchtet. Die Falschdichter dagegen
gehören zu den Volksschindern und gehen daher am liebsten mit den Königen, andernfalls
schlagen sie sich zu den Verschwörern (s. Dante).
Der Richtigdichter wohnt nicht auf den eisigen Höhen der Übermenschen, wo die
Menschheit abstirbt, sondern in ihren Tiefen, wo die ewigen Lebens-, Denk- und
Sprachquellen rauschen. Der D., dem eine staatliche Anerkennung zuteil wird,
ist verdächtig, wenn er nicht, wie Goethe und Schiller, die sich den Adel
verliehen, über jeden Verdacht erhaben ist. Ein dichtender Mensch, der
sich zur guten, also zur blöden Gesellschaft zählt, ist ein Undichter (s. Unflat).
In der freien Menschheit wird jeder sein eigener Dichter und Schicksalsmacher
sein - (se)
Dichter (2) Er sah sich noch, wie er stundenlang in einem
kleinen Literatur-Lexikon geblättert hatte, das die Kurzbiografien aller möglichen
Dichter und Schriftsteller enthielt. Es waren einige
Seiten darin, auf denen die Porträts der bekanntesten Schriftsteller, in Paßbild-Größe,
aneinandergereiht waren. Auf nicht einem der Bilder fand er die mindeste Ähnlichkeit
mit seinem Gesicht. Nichts von dem, was er für die Charakteristika eines Dichters
hielt, ließ sich, auch nicht in vorsichtiger Abwandlung, mit einem Merkmal von
ihm vergleichen. Die Dichter verfügten über hohe Stirnpartien, schmale gebogene
Nasen, hervorspringende Backenknochen und große, weit
offene Augen, die, ganz der Art ihrer Dichtungen angepaßt,
entweder verschleiert oder glasklar blickten ... nichts dergleichen bei ihm:
seine Augen waren zusammengekniffen, sie spähten hinter einem Schutzwall hervor,
dieser Wall war die Verstellung. Auch von den Krankheiten der Dichter, von denen
jede Menge zu lesen war, konnte man bei ihm keinen Anflug bemerken: sie litten
an Schwindsucht, Syphilis, hatten zuviel oder
zuwenig weiße Blutkörperchen, sie waren von Gehirnschlägen oder von geistiger
Umnachtung bedroht. Bei ihm war es das Gegenteil: in seinem Körper steckte eine
rohe, unverwüstliche, geradezu gnadenlose Gesundheit; er fror nicht im Winter
und schwitzte nicht im Sommer, seine Augen erkannten noch die winzigsten der
Buchstaben auf der Tafel an der Wand des Augenarztes, ein ums andere Mal war
er in der Schule zum Pult gerufen worden, damit an seiner gleichmäßig arbeitenden
Bauchmuskulatur eine vorbildliche Atemtechnik demonstriert
werden konnte. -
Wolfgang Hilbig, Das Provisorium. Frankfurt am Main 2001 (Fischer-Tb. 15099,
zuerst 2000)
Dichter (3) Ein junger Officier will gern heyrathen und
spricht darüber mit seinem Bruder, welcher ihm sein Vorhaben auszureden sucht.
Er bleibt aber bey seinem Entschlusse und verliebt sich erstlich in ein reiches
Mädchen, was er nicht gesehn hat; alsdann da ihn
diese ausschlägt und er sich sehr darüber betrübt, in ein anderes artiges Frauenzimmer,
ohne Vermögen, dann in eine reiche ältere Person, die ihn aus Gewissenszweifeln
ausschlägt und Herr[n]hutherinn wird. So gelangt er nach dreyfacher
Betrübniß zur Ruhe und Zufriedenheit mit seinem Stande und wird ein großer Dichter.
- Novalis
Dichter (4) Geschlagen war die Schlacht von Clontarf, in der der Norweger gedemütigt wurde, da sprach der Hohe Herrscher mit dem Dichter und sagte zu ihm:
»Die leuchtendsten Heldentaten verlieren ihren Glanz, werden sie nicht in Worte gemünzt. Ich will, daß du meinen Sieg und mein Lob singst. Ich werde Aeneas sein; du mein Vergil. Hältst du dich für fähig, diese Tat zu vollbringen, die uns beide unsterblich machen wird?«
»Ja, König«, sagte der Dichter. »Ich bin der Ollam. Zwölf Winter lang habe
ich die Disziplinen der Metrik studiert. Ich kenne die dreihundertsechzig Fabeln
auswendig, die den Grund der echten Poesie bilden. Die Zyklen von Ulster und
Munster sind in den Saiten meiner Harfe. Die Gesetze ermächtigen mich, die archaischsten
Worte der Sprache und die komplexesten Metaphern in all ihrer Fülle zu verwenden.
Ich beherrsche die geheime Schrift, die unsere Kunst vor den zudringlichen Blicken
des gemeinen Volkes schützt. Ich kann die Liebesleidenschaften feiern, die Viehraubzüge,
die Seefahrten, die Kriege. Ich kenne die mythologischen Abstammungen sämtlicher
Königshäuser Irlands. Ich bin im Besitz der Kräfte der Krauter, der astrologischen
Bedeutungen, der Mathematik und des kanonischen Rechts. In öffentlichem Wettstreit
habe ich meine Rivalen besiegt. Ich habe mich in der Satire geübt, die Hautkrankheiten
hervorruft, sogar den Aussatz. Ich weiß das Schwert zu führen, wie ich in deiner
Schlacht bewiesen habe. Nur eines vermag ich nicht: dir zu danken für das Geschenk,
das du mir machst.« - Jorge Luis Borges, Spiegel und Maske. In: Spiegel und
Maske. Erzählungen 1970 bis 1983. Frankfurt am Main 2000 (Fischer Tb. 10589)
Dichter (5) Unsere Gäste mochten ihn nicht leiden, vielleicht mochten sie ihn aber auch, doch immerfort flickten sie ihm am Zeug, weil der Dichter im Restaurant nicht nur den Rock ab- und anlegte, sondern auch die Schuhe aus- und wieder anzog, je nachdem wie seine alle fünf Minuten wechselnde Stimmung bei der Suche nach dem neuen Menschen war, zog er die Galoschen aus oder an; dann gossen ihm die Gäste, sobald er die Galoschen abgestreift hatte, Bier hinein oder Kaffee, alle guckten und verfehlten mit der Gabel den Mund, weil sie beim Essen hinüberschielten, ob der Dichter die Galoschen anzog und ihm der Kaffee dabei aus den Schuhen schwappte oder das Bier, und er tobte los und schrie, daß es durchs Restaurant hallte: »Du üble, törichte und hinterhältige Brut... daß die Katen euch holen...«, und dann weinte er, aber nicht vor Wut, sondern vor Glück, denn er hielt das Bier in den Galoschen für eine Aufmerksamkeit, weil die Stadt auf ihn zählte, weil sie ihm zwar keinerlei Ehren erwies, ihn aber als aufrechten Jüngling schätzte...
Am schlimmsten aber war es, wenn sie ihm die Galoschen mit einem Stift festnagelten
und er hineinschlüpfte, wenn er zum Tisch zurück wollte und nicht konnte, fast
stürzte er hin, wie oft fiel er auf die Hände, so fest
waren die Galoschen angenagelt, und wieder beschimpfte er die Gäste als übel,
töricht und hinterhältig, doch sogleich verzieh er ihnen wieder und bot ihnen
eine Zeichnung oder einen Gedichtband an, wofür er sofort kassierte, um seinen
Lebensunterhalt zu bestreiten...
- Bohumil Hrabal, Ich habe den englischen König bedient.
Frankfurt am Main 1990 (zuerst 1971)
Dichter (6)
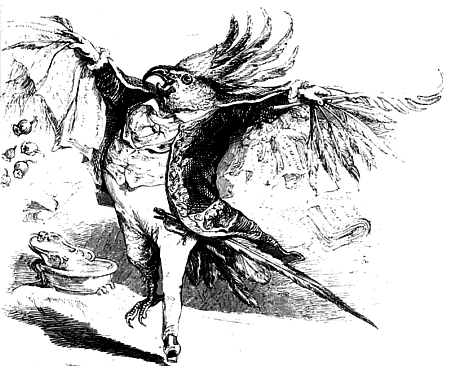
Ich bin der große Dichter Kakatogan!
- (grand)
Dichter (7) D. H. Lawrence sah aus wie ein
gipserner Gartenzwerg, der in einem Vorgarten auf einem Fliegenpilz sitzt. Gleichzeitig
hatte er eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Selbstporträt van Goghs. Er wirkte
verfilzt und feucht und sah aus, als sei er gerade erst von einer unbequem verbrachten
Nacht in einer sehr finsteren Höhle zurückgekehrt, wo er sich vielleicht in
der Finsternis vor etwas versteckt hatte, auf das er seinerseits zugleich Jagd
machte. - Edith Sitwell, Mein exzentrisches Leben. Frankfurt am Main 1994
(Fischer-Tb. 12126, zuerst 1965)
Dichter (8) Als ich Dylan Thomas zum ersten Mal begegnete, hatte ich sogleich den Eindruck, Rubens habe es sich in den Kopf gesetzt, einen jugendlichen Silen zu malen. Er war nicht groß, aber überaus breitschultrig und erweckte den Eindruck außergewöhnlicher Kraft, Robustheit und im Übermaß vorhandener Lebenskraft. (Ein Eindruck, den seine rötlich-bernsteinfarbenen Locken, kräftig wie die zwischen den Hörnern eines jungen Stiers, noch verstärkten.) Das Porträt, das Mr. Augustus John von ihm gemalt hat, ist zwar schön, läßt ihn aber wie einen Cherub wirken. So ansprechend es ist, das Gefühl erzengelgleicher Kraft, das man bei Dylans Anblick hatte, gibt es, zumindest nach Ansicht der Verfasserin, nicht wieder.
Von vorn sah er weitgehend so aus, wie William Blake in jungen Jahren
ausgesehen haben muß. Er hatte - wie dieser - große Augen,
die zuerst den Eindruck erweckten, als nähmen sie nichts wahr; in Wirklichkeit
aber sahen sie alles, während ihr Blick in unmeßbare
Fernen gerichtet war. - Edith Sitwell, Mein exzentrisches Leben. Frankfurt am Main 1994
(Fischer-Tb. 12126, zuerst 1965)
Dichter (9) Einem Mann fällt es ein, sechs
oder sieben gemeinhin rätselhafte Wörter zusammenzustellen.
Er kann sich nicht beherrschen und sagt sie schreiend auf, stehend, im Mittelpunkt
eines Kreises, den die auf der Erde lagernden Zauberer
und das Volk bilden. Wenn das Gedicht
nicht erregt, geschieht nichts; wenn die Wörter des Dichters sie überwältigen,
rücken alle unter der Herrschaft heiligen Schreckens (under a holy dread)
schweigsam von ihm ab. Sie fühlen, daß der Geist ihn
berührt hat: niemand spricht mit ihm oder blickt ihn
an. nicht einmal seine Mutter. Nun ist er kein Mensch mehr, sondern ein Gott.
und jeder kann ihn töten. Der Dichter, wenn er kann,
sucht Zuflucht in den Sandwüsten des Nordens.
- J. L. Borges, David Brodies Bericht, In:
J.L.B.,
Blaue Tiger und andere Geschichten. München 1988 (zuerst 1970)
Dichter (10) Ariost scheint ein heller,
heiterer und problemloser Dichter zu sein, und doch bleibt er mysteriös: In
seiner nicht nachlassenden Meisterschaft beim Bauen von Stanzen auf Stanzen
scheint er nur damit beschäftigt, sich selbst zu verbergen. Gewiß ist er weit
entfernt von der tragischen Tiefe, mit der Cervantes ein Jahrhundert
später im Don Quijote die Auflösung der Ritterliteratur vollendet. Aber
unter den wenigen Büchern, die sich retten können, als der Pfarrer und der Barbier
die Bibliothek anzünden, die den Hidalgo von La Mancha in den Wahnsinn getrieben
hat, ist der Orlando furioso. - (rol)
Dichter (11) Die glücklichen Dichter Afrikas
haben nicht zu befürchten, daß man sie vernachlässigt und in Dürftigkeit geraten
läßt, wie es in gesitteten Ländern so oft geschieht. Man kann sie in zwei
Klassen einteilen. Die zahlreichste machen die Sänger oder Djilliki aus, von
denen es einen oder mehrere in jeder Stadt gibt. Sie singen Gesänge aus dem
Stegreif zum Lob ihrer Vornehmen oder jedes anderen, der Lust hat, sie gut zu
bezahlen. Ein Teil ihres Geschäftes besteht darin, daß sie die Begebenheiten
ihres Landes erzählen, daher begleiten sie in Kriegszeiten die Soldaten ins
Feld, um durch Erinnerung an die großen Taten ihrer Vorfahren den Geist rühmlicher
Nacheiferung in ihnen zu erwecken. Die andere Klasse besteht aus mohammedanischen
Frömmlingen, welche im Lande umherziehen, geistliche Lieder singen und religiöse
Zeremonien verrichten, um den Allmächtigen zu bewegen, daß er entweder Unglück
abwende, oder zu irgendeinem Unternehmen seinen Beistand verleihe. Beide Arten
von wandernden Barden werden vom Volk sehr geachtet und es werden sehr reichliche
Sammlungen für sie veranstaltet. - Mungo Park, Reise
in das Innere von Afrika. Leipzig 1984 (zuerst 1799)
Dichter (12) Er war ein sogenannter Mittelmeermensch. Er hatte einen Bart und einen Bauch, war ein gewaltiger Esser und Raucher und hatte das gewaltige Epos «Das Nordlicht» geschrieben. Ihm zuzuhören war ein Genuß. Am liebsten hatte er junge Leute um sich, Dichter und Maler; er war der Mittelpunkt eines kleinen Kreises, und wenn er so auf dem Sofa lag, das drückende Hosenband halb aufgemacht, hätte er wirklich ein griechischer Philosoph sein können, der seine Schüler um sich versammelte. Auch sein Zeuskopf ließ auf diese Art weiser, beherrschter Lebenskunst schließen. In Wirklichkeit war er ganz anders.
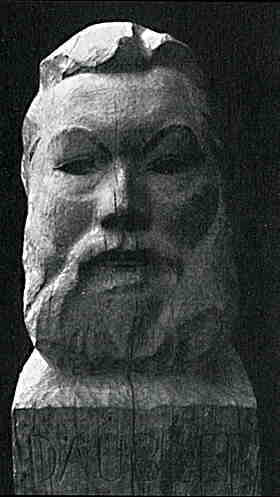
Von
Ernst Barlach, nach:
E. B. mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten,
dargestellt von Catherine
Krahmer. Reinbek bei Hamburg 1984 (rm 335)
Immer gehetzt war er und viel in Geldnot, obwohl er unter anderem eine Monatsrente vom Inselverlag bezog und also genug zum Leben hatte. Das war es nicht — nein, das Geld wollte nicht bei ihm bleiben, es rann von ihm fort und oft in trübe Kanäle. Auch von einer Patronin seiner Kunst, der nicht mehr jungen Frau eines Dresdener Mühlenbesitzers, erhielt er Geld — und das beunruhigte ihn ebenfalls, denn er konnte beim besten Willen nicht mehr als eine platonische Gegenliebe für die Dame aufbringen. Er war ein ängstlicher Mensch und fühlte sich von allen möglichen Gewalten verfolgt.:. Und er war ehrgeizig und betonte immer wieder, wie sehr es ihn quäle, daß er so wenig Anerkennung finde und noch nicht «durch» sei.
Ich sehe ihn noch, wie er mit wütenden, hungrigen Augen aus der Küche kam,
in der seine Schwester das Abendbrot richtete, in jeder Hand eine große
rohe, unabgeschälte Kartoffel. Wütend ging er hin und her, immer mit seinen
Zähnen in die Kartoffeln beißend und sie abschälend wie ein Nagetier.
Die abgekauten Schalenstückchen warf er achtlos irgendwohin — in eine
leere Blumenvase, auf den Kamin, aufs Bücherregal. Auf und ab, auf und
ab ging er wie ein vorsintflutliches Monstrum. Es schnarrte, rasselte und schnalzte;
dazwischen rief er dauernd: «Ich bin noch nicht durch — ich bin noch nicht durch
— » - George Grosz, Ein kleines Ja und ein
großes Nein. Sein Leben von ihm selbst erzählt. Reinbek bei Hamburg 1986, dt.
zuerst
1955
Dichter (13) Er schmeißt die Faust und hämmert einen Zauberschlag in die Luft - und die Welt erstarrt und schrumpft und gestaltet sich zum geometrischen Bild. Das balanciert er nun auf der flachen Hand, und, weil es noch glühend ist vom Schrumpfprozeß, läßt er es zum Abkühlen von der Höhlung der Rechten in die der Linken rollen und nimmt es dann zwischen Daumen und Zeigefinger der Rechten. Daran hindern ihn nicht Hemdsäume, die aus dem Ärmel wulsten, oder Kragenverhältnisse, die ganz aus der Zeit gefallen sind. Dieser Kristall wird nun wie ein rohes Ei gehandhabt, ausgeblasen und wieder vollgedeutet, und Kolumbus-Däubler macht uns die Entdeckung einer neuen Welt handgreiflich vor. - Ernst Barlach, nach: E. B. mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, dargestellt von Catherine Krahmer. Reinbek bei Hamburg 1984 (rm 335)
Dichter (14) Als der Dichter Pindar an einem
Wettstreit in Theben teilnahm, geriet er an ungebildete Hörer und wurde fünfmal
von Korinna besiegt. Pindar warf ihnen Mangel an musischer Bildung vor
und bezeichnete Korinna als eine Sau. - (ael)
Dichter (15) Das Zeitalter, das den Maßschuh aus
fertigen Teilen hervorgebracht hat, und den fertigen Anzug in individueller
Anpassung, scheint auch den aus fertigen Innen- und Außenteilen zusammengesetzten
Dichter hervorbringen zu wollen. Schon lebt der Dichter nach eigenem Maß beinahe
allerorten in einer tiefen Abgeschiedenheit vom Leben, und hat doch nicht mit
den Toten die Kunst gemeinsam, daß sie kein Haus brauchen und kein Essen und
Trinken. - (nach)
Dichter (16) Weil es aber etwas anderes ist, das
Ungesehene zu erkunden und das Ungehörte zu erlauschen als nur den Geist des
Abgestorbenen wieder zu beleben, ist Baudelaire
der erste Seher, König der Dichter, ein wirklicher ›Gott‹.
- Rimbaud, nach: Charles
Baudelaire, Die Tänzerin Fanfarlo und Der Spleen von Paris. Zürich
1977 (detebe 20387)
Dichter (17)
|
Der Dichter im Restaurant Der Dichter glotzt verstockt in Rauch und trinkt Er denkt der vielen Bürger, die ihn hassen, Mißtrauisch schielt der Wirt nach ihm. ein Gast Der Dichter träumt sich Purpur und Palast |
- Max
Herrmann-Neisse, 1913
Dichter (18) Sie fügte hinzu wissen Sie wenn ich
ein Dichter wäre wie Monsieur, dann würde ich schöne Sachen sagen über die Kinder,
die Natur, die Blumen und die Bäume mit ihrem zarten Schleier in diesen Tagen,
haben Sie es bemerkt, die Tage vergehen so schnell, jetzt ist schon Pfingsten,
das helle Grün weicht bald dem harten Grün des Sommers, ja ich wäre unerschöpflich,
aber dazu müßte man in vielen Zungen sprechen können, wie es heißt, den Dichtern
ist das gegeben, sie werden im ganzen Universum verstanden, vielleicht bis zu
den Sternen, ach, die Dichtung, Mademoiselle, das ist das Allerschönste, das
. . . das ... ja das Allerschönste. - (apok)
Dichter (19)
Dichter (20) «Und dann habe ich dich mit dem Dichter betrogen.»
«Dem Dichter?»
«Ja, dem von den ‹Seifenblasen›. Er hatte ein langes Gedicht verfaßt, in dem er meine Schultern besang. Und die letzten vier Zeilen waren mir in Erinnerung geblieben, verfolgten mich, brachten mich zur Verzweiflung, ich wiederholte sie unaufhörlich, ohne es zu wollen. Meinen Körper beschreibend, hieß es, daß er gewollt hätte...
coprirne (bedecken)
le spalle (die Schultern)
con un leggerissimo
scialle (mit einem hauchzarten Schal)
di Smyrne (aus Smyrna)
Ich wurde diese vier Zeilen, von denen drei zu kurz und eine zu lang
war, nicht los. Ich habe mich mit ihm gezankt. Ich habe ihm erklärt, daß
ich ihn verabscheue, daß er mich anwiderte, daß er, statt Seifenblasen
zu machen, die Seife lieber benutzen sollte, um sich den Hals zu waschen.
Ich dachte, er würde anfangen zu weinen oder mir mit einer Unverschämtheit
antworten. Statt dessen sagte er nur: ‹Dreckige müssen sich waschen. Ich,
der ich sauber bin, habe es nicht nötig›.» - Pitigrilli, Ein Mensch jagt nach Liebe. Reinbek bei Hamburg
1987 (zuerst 1929)
Dichter (21) Dem Dichter ist ein ruhiger,
aufmercksamer Sinn - Ideen oder Neigungen, die ihn von irrdischer Geschäftigkeit
und kleinlichen Angelegenheiten abhalten, eine sorgenfreye Lage - Reisen - Bekanntschaft
mit vielartigen Menschen - mannichfache Anschauungen - Leichtsinn
- Gedachtniß - Gabe zu sprechen - keine Anheftung an Einen Gegenstand, keine
Leidenschaft im vollen Sinne - eine vielseitige Empfänglichkeit nöthig. - Novalis,
Fragmente und Studien 1799/1800
Dichter (22) Der dicke Dichter kippte viele Schnäpse, und die Kellnerin, eine Grauhaarige, machte ihre Bleistiftstriche auf den unteren Bierfilz; denn das Schnapsgläschen des Dichters stand auf zwei Bierdeckeln. Er sah geradeaus, zeigte seine fleischerne Gesichtsmaske mit dem roten Pfennigmund und schien sich mit Schnaps aufzublasen. Wahrscheinlich war sein Fett ein Panzer gegen Grobheit. Er redete nichts und hatte um sich seine Freunde, als ob sie ihn abschirmen müßten.
Einer wollte wissen, wie viele Schnäpse der Dichter getrunken hatte, doch
wehrte den die grauhaarige Kellnerin ab: »Das geht nur uns beide etwas an.«
- Hermann Lenz, Seltsamer Abschied. Frankfurt
am Main 1990
Dichter (23) Mußte nicht jeder seine eigenen Gedichte
machen? An den meisten zeitgenössischen Dichtern störte ihn, daß sie sich aussprachen.
Jeder wollte den anderen im Gestehen übertreffen. Ihn interessierte, was man
durch Aufschreiben verschweigen konnte. Das kam wahrscheinlich von seiner Schüchternheit
oder Feigheit oder Unaufrichtigkeit oder Unerwachsenheit.
Da war er wieder bei Annas Kritik. Anna behauptete, man wisse bei ihm nie, ob
er meine, was er sage, oder ob er, wenn er etwas sage, dadurch verberge, was
er meine. So genau empfand Anna. In den Gedichten versuchte er auszudrücken,
daß er, wenn er etwas sage, dadurch immer etwas verheimlichen wolle. Gelänge
es ihm, auszudrücken, was er verheimlicht, wenn er etwas sagt, dann hätte er
ausgedrückt, warum er dichten wollte. Andere bauen ihre Kindereisenbahn bis
an die Wände des Hobbyraums oder sammeln Steine, bis die Vitrinen voll sind,
oder krümmen sich über Briefmarken, er dichtete, basta. Das war allerdings eine
Lieblingstätigkeit, die man verheimlichen mußte. Es gab dafür keinen Verein.
Seine Lieblingstätigkeit ertrug keine Zeugen. Auch nicht in der eigenen Familie.
Sie brauchte auch keine Zeugen. Der Ton der Verstiegenheit war sein Lieblingston.
Aber nur solang, als er mit diesem Ton allein war. - Martin Walser, Das Schwanenhaus. Frankfurt am Main
1982
Dichter (24) Diese dürren Zitzen des Kunsttiers,
an dem seine Lehrlinge ohne Verstand saugen. Sie lernen nicht einmal, elegante
Gebärden zu machen, die sich sofort in Luft auflösen. Sie hat schon erfolgreichere
Gemälde gesehen. Sie schaut die Dichter an, die, was sie auch gern täte (blaß,
bärtig, wichtig sein!), im Fernsehen ihre unklaren Absichten zum Besten geben
und andere zum Besten halten (was sie allein mit Worten alles erreichen möchten!)
Diese Worte klingen so goldblond, daß sie nach unsachgemäßer Aufbewahrung geradezu
riechen. Diese als Männer unansehnlichen Künstler liegen auf ihren Betten und
sprechen mit allem, was eigens zu ihnen herkommt. Sie schreiben und sprechen
beidseitig. Beides aber zu laut. Oder in mottenhaften Zwischenbereichstönen.
Diese Fischentschupper, was die mit der Sprache treiben! Und mit ihren Anschauungen
gar! Der Dichter schlupft aus seiner eleganten Larve, die er in die Leibshöhlungen
von anderen Leuten, die weniger glücklich sind als er, geschmuggelt hat. Dieser
Parasitist. Schlüpft aber nicht als ein herziger Schmetterling, sondern als
ein Schatten von Versäumnissen, die nie wieder passieren dürfen, so furchtbar
klingen sie auf dem Papier. Häßliche junge Männer schaudern ohne Geheimnis in
sich. - Elfriede Jelinek, Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr. Reinbek bei Hamburg
1993
Dichter (25) Der Dichter verwandelt unterschiedslos die Niederlage in Sieg, den Sieg in Niederlage, Kaiser schon vor der Geburt, besorgt allein um die Ernte des Azurs.
Als Magier der Unsicherheit hat der Dichter nur Adoptivbefriedigungen. Immer unvollendete Asche.
Zorn und Geheimnis verführten ihn jeweils und brauchten ihn auf. Dann kam das Jahr, das seine Agonie vollendete: Agonie eines Steinbrechs.
Der Dichter erzürnt sich nicht über das widrige Erlöschen im Tod, sondern verwandelt, voller Vertrauen auf seinen besonderen Tastsinn, alles in langsträhnige Wolle.
Des Dichters Wohnung ist der fraglichsten eine; der Schlund eines traurigen Feuers beliefert seinen Tisch aus weichem Holz.
Die Vitalität des Dichters ist keine Vitalität aus dem Jenseits, sondern ein glitzernder Punkt, hier und jetzt, von gegenwärtigen Transzendenzen und pilgernden Stürmen.
Der Dichter trägt in sich zwei Arten von Evidenz: die eine gibt sogleich all ihren Sinn preis in der Vielfalt der Formen, die der äußeren Wirklichkeit hörig sind; sie schürft selten tief, sie ist bloß treffend; die andre ist ins Gedicht eingeflossen, sie kündet Gebot und Auslegung der mächtigen, launischen Götter, die den Dichter bewohnen, verhärtete Evidenz, die nicht welkt noch erlischt. Ihre Hegemonie ist ihr Merkmal. Kundgemacht einmal, nimmt sie beträchtlichen Raum ein.
Auf jeden Zusammenbruch der Beweise antwortet der Dichter mit einer Salve Zukunft.
Der Dichter wühlt mit Hilfe uneichbarer Geheimnisse Stimme und Gestalt seiner Quellen auf.
- Alles aus: René Char, Partage formel - Unanfechtbarer Anteil,
in: R. C., Zorn und Geheimnis. Frankfurt am Main
1991 (zuerst 1948)
Dichter (26) Der Charakter von Young Soult Dieser
wahrhaft bedeutende Dichter ist dreiundzwanzig Jahre alt. Er ist etwa mittelgroß
und offenbar bei guter Gesundheit. Seine Gesichtszüge sind ebenmäßig, und seine
Augen sind groß und ausdrucksvoll. Sein Haar ist dunkel, doch er trägt eine
solche Kräuselfrisur, als wolle er den Anschein erwecken, er käme geradewegs
aus einem Ginsterbusch gekrochen. Seine Kleider sind gewöhnlich zerrissen, und
sie umschlottern ihn auf eine sehr nachlässige und unordentliche Weise. Seine
Schuhe sind oft ausgetreten und die Strümpfe voller Löcher. Der Gesichtsausdruck
ist wild und abgehärmt, und fortgesetzt verzieht er seinen Mund nach der einen
oder anderen Seite, Im Wesen hat er etwas Diabolisches, doch ist er menschlich
und gutmütig. Er scheint ständig in einem Zustand starker Erregung zu arbeiten,
hervorgerufen durch übermäßiges Trinken und Spielen, dem er unglücklicherweise
in starkem Maße verfallen ist. Seine Gedichte zeugen von glänzender Einfallskraft,
doch ist sein Versbau mangelhaft. Die Themen und die Sprache sind schön, aber
ihre Gestaltung hat keine Harmonie, und darum meine ich, daß er sein Bestes
im Blankvers leisten könnte. Tatsächlich habe ich gehört, daß er ein solches
Gedicht zur Veröffentlichung vorbereitet, von dem man erwartet, daß es sein
bestes werden wird. Er verfügt über echte schöpferische Begabung, die er unter
großen Mühen veredelt hat. Seine Anfänge waren weniger bedeutend, doch glaube
ich, daß er am Ende großartige Werke schaffen und sein Name, zusammen mit denen
der bedeutendsten Männer seines Geburtslandes, in die Annalen eingehen wird.
-
(bronte)
Dichter (27) Sie schaut die Dichter an, die, was
sie auch gern täte (blaß, bärtig, wichtig sein!), im Fernsehen ihre unklaren
Absichten zum Besten geben und andere zum Besten halten (was sie allein mit
Worten alles erreichen möchten!) Diese Worte klingen so goldblond, daß sie nach
unsachgemäßer Aufbewahrung geradezu riechen. Diese als Männer unansehnlichen
Künstler liegen auf ihren Betten und sprechen mit allem, was eigens zu ihnen
herkommt. Sie schreiben und sprechen beidseitig. Beides aber zu laut. Oder in
mottenhaften Zwischen bereichstönen. Diese Fischentschupper, was die mit der
Sprache treiben! Und mit ihren Anschauungen gar! Der Dichter schlupft aus seiner
eleganten Larve, die er in die Leibshöhlungen von anderen Leuten, die weniger
glücklich sind als er, geschmuggelt hat. Dieser Parasitist. Schlüpft aber nicht
als ein herziger Schmetterling, sondern als ein Schatten von Versäumnissen,
die nie wieder passieren dürfen, so furchtbar klingen sie auf dem Papier. Häßliche
junge Männer schaudern ohne Geheimnis in sich. - Elfriede Jelinek, Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr.
Reinbek bei Hamburg 1998
Dichter (28)
Dichter (29) Poetisch sein und Poet sein,
fuhr Faber fort, das sind zwei verschiedene Dinge, man mag dagegen
sagen, was man will. Bei dem letzteren ist, wie selbst unser großer
Meister Goethe eingesteht, immer etwas Taschenspielerei, Seiltänzerei
usw. mit im Spiele. - Das ist nicht so, sagte Friedrich ernst und
sicher, und wäre es so, so möchte ich niemals dichten. Wie wollt Ihr,
daß die Menschen Eure Werke hochachten, sich daran erquicken und erbauen
sollen, wenn Ihr Euch selber nicht glaubt, was Ihr schreibt und durch
schöne Worte und künstliche Gedanken Gott und Menschen zu überlisten
trachtet? Das ist ein eitles, nichtsnutziges Spiel, und es hilft Euch
doch nichts, denn es ist nichts groß, als was aus einem einfältigen
Herzen.kommt. Das heißt recht dem Teufel der Gemeinheit der immer in der
Menge wach und auf der Lauer ist, den Dolch selbst in die Hand geben
gegen die göttliche Poesie.
Wo soll die rechte, schlichte Sitte, das treue Tun, das schöne Lieben,
die deutsche Ehre und alle die alte herrliche Schönheit sich
hinflüchten, wenn es ihre angebornen Ritter, die Dichter, nicht wahrhaft
ehrlich, aufrichtig und ritterlich mit ihr meinen? Bis in den Tod
verhaßt sind-mir besonders jene ewigen Klagen, die mit weinerlichen
Sonetten die atte schöne zurückwinseln wollen, und, wie ein
Strohfeuer, weder die Schlechten verbrennen, noch die Guten erleuchten
und erwärmen. Denn wie wenigen möchte doch das Herz zerspringen, wenn
alles so dumm geht, und habe ich nicht den Mut, besser zu sein als meine
Zeit, so mag ich zerknirscht das Schimpfen lassen, denn keine Zeit ist
durchaus schlecht. Die heiligen Märtyrer, wie sie, laut ihren Erlöser
bekennend, mit aufgehobenen Armen in die Todesflammen sprangen - das
sind des Dichters echte Brüder, und er soll ebenso fürstlich denken von
sich; denn so wie sie den ewigen Geist Gottes auf Erden durch Taten
ausdrückten, so soll er ihn aufrichtig in einer verwitterten,
feindseligen Zeit durch rechte Worte und göttliche Erfindungen verkünden
und verherrlichen. Die Menge, nur auf welliche Dinge erpicht, zerstreut
und träge, sitzt gebückt und blind dräußen im warmen Sonnenscheine und
langt rührend nach demm ewigen Lichte, das sie niemals erblickt. Der
Dichter hat einsam die schönen Augen offen; mit Demut und Freudigkeit
betrachtet er, selber erstaunt, Himmel und Erde, und das Herz geht ihm
auf bei der überschwenglichen Aussicht, und so besingt er die Welt, die,
wie Memnons Bild, voll stummer Bedeutung, nur dann durch und durch
erklingt, wenn sie die Aurora eines dichterischen Gemütes mit ihren
verwandten Strahlen berührt. - - Joseph von Eichendorff, Ahnung und Gegenwart (zuerst 1815)

|
||
 |
||
 |
 |
|
 |
||

 |
||
  |
  |
|