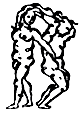 odenlosigkeit
Der Effekt des Bodenlosen tritt beim Überqueren von Ballungszentren
nicht plötzlich auf sondern unerwartet weg. Eilig anwesende Reporter: »Wann
kam Ihnen der Gedanke?« Keine Antwort — auch
eine Antwort? Es stimmt nämlich nicht, daß Gedanken im Gehen
kommen; sie gehen vielmehr, Rülpser durch die
Fußsohlen, eine abstruse Vorstellung der Beine, nacheinander, im Gehen
von uns. Ein Entweichen über Hohlräumen, Schächten, Kanalisationen, ein
Abfließen ins Kabel-Genabel. Man könnte sagen, es kommt zu einer Art Erdung,
aber wie gesagt, es geht bloß durch die Lappen. Gewissermaßen ein Wegtreten,
das ist der Gedanke.
odenlosigkeit
Der Effekt des Bodenlosen tritt beim Überqueren von Ballungszentren
nicht plötzlich auf sondern unerwartet weg. Eilig anwesende Reporter: »Wann
kam Ihnen der Gedanke?« Keine Antwort — auch
eine Antwort? Es stimmt nämlich nicht, daß Gedanken im Gehen
kommen; sie gehen vielmehr, Rülpser durch die
Fußsohlen, eine abstruse Vorstellung der Beine, nacheinander, im Gehen
von uns. Ein Entweichen über Hohlräumen, Schächten, Kanalisationen, ein
Abfließen ins Kabel-Genabel. Man könnte sagen, es kommt zu einer Art Erdung,
aber wie gesagt, es geht bloß durch die Lappen. Gewissermaßen ein Wegtreten,
das ist der Gedanke. - (pas)
Bodenlosigkeit (2) Es gibt insgesamt
zwölf materielle Elementarteilchen. Sechs davon
sind LEPTONEN, das heißt Teilchen, die nicht der starken Wechselwirkung
unterliegen (dazu gehört zum Beispiel das Elektron). Die anderen sechs
sind QUARKS, das heißt Teilchen, die der starken Wechselwirkung unterliegen
und aus denen die HADRONEN bestehen. Alle materiellen Teilchen sind Fermionen
(siehe BOSON UND FERMION), das sind Teilchen, die dem AUSSCHLIESSUNGSPRINZIP
oder Pauliverbot gehorchen, wonach zwei Fermionen einander nicht durchdringen
können.
Die für die Wechselwirkungen verantwortlichen Teilchen sind Bosonen;
sie gehorchen nicht dem Ausschließungsprinzip. Insgesamt gibt es dreizehn
solcher Teilchen: das (noch nicht entdeckte) Graviton für die Gravitation,
das PHOTON für die elektromagnetische Wechselwirkung, die drei »intermediären
Bosonen« W+, W- und Z° für die schwache Wechselwirkung
und acht Gluonen für die starke Wechselwirkung.
Bedenkt man, dass jedem Teilchen noch ein Antiteilchen zugeordnet ist,
gibt es insgesamt mehr als vierzig Elementarteilchen. Manchen Physikern
ist diese Zahl zu hoch; sie meinen, es dürfe nur eine kleine Zahl echter
Grundstrukturen geben. In ihren Augen ist die heutige Klassifikation
allzu vielfältig. Mehrere Wege zu einer größeren Einheit sind denkbar.
Obwohl es keinerlei theoretische oder experimentelle Beweise gibt, die
in diese Richtung weisen, könnte man die Hypothese aufstellen, dass es
sich bei den heutigen Elementarteilchen in Wirklichkeit um zusammengesetzte
Teilchen handelt, so dass sich ihre Beschreibung eines Tages auf eine kleinere
Zahl neuer (d. h. noch nicht entdeckter) und dann wirklich elementarer
Teilchen zurückführen lassen wird. Man kann sich sogar vorstellen, dass
die Suche nach den elementaren Bausteinen niemals an ein Ende gelangt,
weil man unterhalb der jeweils als elementar geltenden Teilcher immer wieder
neue Strukturen entdeckt, die diese Teilchen als zusammengesetzt ausweisen.
- (thes)
Bodenlosigkeit (3) Maigret öffnete
den Schrank, um seinen nassen Mantel und den Hut hineinzuhängen, sah sein
Gesicht kurz in dem über dem Waschbecken angebrachten Spiegel
und hätte sich beinahe die Zunge herausgestreckt,
so mies fand er seinen Anblick. Gewiß, der Spiegel verzerrte
die Bilder ein wenig. Dennoch hatte der Kommissar
den Eindruck, vom Quai de la Gare einen Kopf mitgebracht zu haben, der
dem der Leute ähnelte, die dieses beklemmende Haus bewohnten.
Nach so vielen Jahren bei der Polizei glaubt man sicher nicht mehr an
den Weihnachtsmann, an die Welt der erbaulichen Bücher und der Bilder von
Epinal, mit den Reichen auf der einen Seite und den Armen auf der anderen,
mit den anständigen Menschen und den Strolchen, mit den Musterfamilien,
die wie beim Fotografen um einen lächelnden Patriarchen gruppiert sind.
Manchmal klammerte er sich jedoch unbewußt an Kindheitserinnerungen
und schreckte vor bestimmten Erscheinungen der Wirklichkeit wie ein Jüngling
zurück. Er war selten so entsetzt gewesen wie bei den Lachaumes. Dort hatte
er richtig das Gefühl gehabt, den Boden unter den Füßen zu verlieren, und
noch jetzt spürte er einen bitteren Nachgeschmack, hatte er das Bedürfnis,
von seinem Büro wieder Besitz zu ergreifen, sich behäbig in seinen Sessel
zu setzen, mit der Hand über seine Pfeifen zu streichen, als wolle er sich
vergewissern, daß es eine alltägliche Wirklichkeit gab. - Georges
Simenon, Maigret und die widerspenstigen Zeugen. Zürich 1980 (detebe 20716,
zuerst 1959)
Bodenlosigkeit (4) Ein lebensmüder
Astronaut, der sich einem kosmischen Staubsauger dieses Kalibers
bewusst näherte, wäre den Gezeitenkräften schutzlos ausgeliefert.
Bereits in der mittelbaren Umgebung eines Schwarzen Loches, räumlich
noch vor dem Ereignishorizont, würde unser mutiger Freund ein immenses
Ziehen und Zerren fühlen, bis ihn der "poststellare" Gezeiteneffekt
förmlich zu einem unförmigen Etwas umformen, besser gesagt zerfetzen
würde. Der Sturz unseres Astronauten in die Singularität, jenem
unendlich dichten und heißen zentralen Punkt eines Schwarzen Loches, in
dem alle Qualitäten und Quantitäten von Raum, Zeit und Materie auf
undefinierbare Art und Weise enden oder eine wie auch immer anders
geartete "Wiedergeburt" erleben, entspräche also lange vor dem
Erreichen des anvisierten Zielgebietes einem Fall ins Bodenlose.
- Harald Zaun, telepolis
vom 8.9.2003
Bodenlosigkeit (5) Das
Leben wird hier besonders leicht neu. Die Menschen haben hinter sich wenig mehr,
woher sie kommen. Dies Berlin, wie es selber ohne Boden
zu sein scheint, stößt von jedem ab. Die vielen Häuser, wie über Nacht aufgeschossen:
so plötzlich, meint man, könnten sie auch wieder verschwinden.
Wie am ersten Tag riechen sie nach dem neuen Kalk, woraus sie gebacken sind;
sie werden nicht alt, sondern zerfallen bloß. Die Stadt scheint in dem öden
Land völlig frisch und unverbunden zu beginnen. So bodenlos ist der bekannte,
oft bemerkte künstliche Eindruck - und so künstlich ist er freilich selber.
Denn in der Tat ist auch hier sehr Boden, nur ein eigener, sonderbarer, der
sich in die Stadt durchaus hineinschickt, den sie nicht so überwindet, wie man
denkt. Einer aus Sumpf, worin Berlin schwimmt, aus Sand,
worauf es gebaut ist. Nicht mehr so frisch und abgestoßen, doch auch nicht mehr
so künstlich geht die Stadt aus dem Blick auf ihre merkwürdige Landschaft auf.
Diese selber stimmt nicht, so wenig wie die aufregend unwirkliche Stadt. -
Ernst Bloch, Berlin aus der Landschaft gesehen. In: E.B., Verfremdungen II. Frankfurt am Main 1965 (BS
120, zuerst 1932)
Bodenlosigkeit (6) Die pyrrhonischen
Skeptiker hoben jeden Beweis auf und ließen nichts
gelten, weder ein Kriterium noch ein Anzeichen, noch einen Grund, noch Bewegung,
noch Belehrung, noch Werden, noch den Satz, daß es etwas gebe, was von Natur
gut oder übel sei; denn jeder Beweis, sagen sie, besteht entweder aus bewiesenen
Dingen oder aus unbewiesenen. Besteht er aus erweislichen, so bedürfen auch
diese eines Beweises, und so fort ins Unendliche; wenn aber aus unbewiesenen,
so wird, sei es nun, daß alles oder daß einiges oder daß auch nur eines zweifelhaft
bleibt, auch das Ganze unbewiesen sein. Scheinen aber,
sagen sie, gewisse Dinge vorhanden zu sein, die keines Beweises bedürfen, so
muß doch die Urteilskraft derer, die dieses annehmen, in einem sonderbaren Lichte
erscheinen, wenn sie nicht merken, daß eben gerade dieses, daß sie ihre Beglaubigung
in sich selbst tragen, des Beweises benötigt. Denn man kann doch das Dasein
von vier Elementen nicht aus dem Dasein der vier Elemente erhärten. Zudem muß,
wenn die Einzelbeweise als unglaubwürdig verworfen werden, auch der allgemeine
Beweis ungültig sein. Um aber zu erkennen, daß wirklich ein Beweis vorliegt,
bedarf es eines Kriteriums (Beweisgrundes), und dafür, daß es ein Kriterium
gibt, bedarf es wiederum eines Beweises; mit beiden also kann der Verstand nichts
anfangen, da sie nur in Beziehung aufeinander gelten. Wie kann man also das
Unbekannte dem Verstände begreiflich machen, wenn man den Beweis nicht kennt?
Die Frage ist doch nicht die, ob es so scheint, sondern ob es sich dem wirklichen
Bestände nach so damit verhält. Sie erklären also die Dogmatiker für Toren;
denn was aus bloßer Voraussetzung erschlossen wird, das hat nicht die Bedeutung
eigentlicher Einsicht, sondern bloßer Annahme. Nach solchem Verfahren kann man
auch für das Unmögliche Beweise aufbringen. - (diol)
Bodenlosigkeit (7) Sie
wissen es, die Würdigen, wenn sie es auch nicht sagen: causa prima [die
erste (Welt-)Ursache] ist, eben so gut wie causa sui [Ursache ihrer selbst],
eine contradictio in adjecto; obschon der erstere Ausdruck viel häufiger
gebraucht wird, als der letztere, und auch mit ganz ernsthafter, sogar feierlicher
Miene ausgesprochen zu werden pflegt, ja Manche, insonderheit Englische Reverends
[geistliche Herren], recht erbaulich die Augen verdrehn, wenn sie, mit Emphase
und Rührung, the first cause [die erste Ursache], - diese contradictio
in adjecto, - aussprechen. Sie wissen es: eine erste Ursache ist gerade
und genau so undenkbar, wie die Stelle, wo der Raum ein Ende hat, oder der Augenblick,
da die Zeit einen Anfang nahm. Denn jede Ursache ist eine Veränderung,
bei der man nach der ihr vorhergegangenen Veränderung, durch die sie herbeigeführt
worden, nothwendig fragen muß, und so in infinitum, in infinitum! Nicht
ein Mal ein erster Zustand der Materie ist denkbar, aus dem, da er nicht noch
immer ist, alle folgenden hervorgegangen wären. Denn, wäre er an sich ihre Ursache
gewesen; so hätten auch sie schon von jeher seyn müssen, also der jetzige nicht
erst jetzt. Fieng er aber erst zu einer gewissen Zeit an, kausal zu werden;
so muß ihn, zu der Zeit, etwas verändert haben, damit er aufhörte zu ruhen:
dann aber ist etwas hinzugetreten, eine Veränderung vorgegangen, nach deren
Ursache, d. h. einer i h r vorhergegangenen Veränderung,
wir sogleich fragen müssen, und wir sind wieder auf der Leiter der Ursachen
und werden höher und höher hinaufgepeitscht von dem unerbittlichen Gesetze der
Kausalität, - in infinitum, in infinitum.
(Die Herren werden sich doch nicht etwan entblöden, mir von einem Entstehn der
Materie selbst aus nichts zu reden? weiter unten stehn Korollarien, ihnen aufzuwarten.)
- Schopenhauer, Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden
Grunde. Zürich 1977
Bodenlosigkeit (8) Im Dungting-See
ist ein Berg. In dem Berge ist ein Loch. Es ist so tief,
daß es keinen Boden hat.
Einst ging ein Fischer dort vorüber, der glitt aus und fiel
hinein. Er kam in eine Gegend voll gewundener Wege,
die über Berg- und Talhänge führten mehrere Meilen weit. Schließlich kam er
an ein Drachenschloß, das auf einer großen Ebene lag. Dort gab es grünen Schlamm,
der reichte ihm bis an die Knie. Er ging zum Tor des Schlosses. Ein Drache bewachte
es; der spie Wasser, das in lichten Nebel zerstäubte. Innerhalb des Tores war
ein kleiner, ungehörnter Drache, der hob den Kopf und zeigte ihm die Krallen
und ließ ihn nicht hinein.
Der Fischer brachte mehrere Tage in der Höhle zu. Er stillte seinen Hunger
mit dem grünen Schlamm, der wie Reisbrei schmeckte.
Schließlich fand er sich wieder heraus. - (chm)
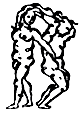 odenlosigkeit
Der Effekt des Bodenlosen tritt beim Überqueren von Ballungszentren
nicht plötzlich auf sondern unerwartet weg. Eilig anwesende Reporter: »Wann
kam Ihnen der Gedanke?« Keine Antwort — auch
eine Antwort? Es stimmt nämlich nicht, daß Gedanken im Gehen
kommen; sie gehen vielmehr, Rülpser durch die
Fußsohlen, eine abstruse Vorstellung der Beine, nacheinander, im Gehen
von uns. Ein Entweichen über Hohlräumen, Schächten, Kanalisationen, ein
Abfließen ins Kabel-Genabel. Man könnte sagen, es kommt zu einer Art Erdung,
aber wie gesagt, es geht bloß durch die Lappen. Gewissermaßen ein Wegtreten,
das ist der Gedanke.
odenlosigkeit
Der Effekt des Bodenlosen tritt beim Überqueren von Ballungszentren
nicht plötzlich auf sondern unerwartet weg. Eilig anwesende Reporter: »Wann
kam Ihnen der Gedanke?« Keine Antwort — auch
eine Antwort? Es stimmt nämlich nicht, daß Gedanken im Gehen
kommen; sie gehen vielmehr, Rülpser durch die
Fußsohlen, eine abstruse Vorstellung der Beine, nacheinander, im Gehen
von uns. Ein Entweichen über Hohlräumen, Schächten, Kanalisationen, ein
Abfließen ins Kabel-Genabel. Man könnte sagen, es kommt zu einer Art Erdung,
aber wie gesagt, es geht bloß durch die Lappen. Gewissermaßen ein Wegtreten,
das ist der Gedanke. 









