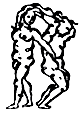 enommenheit Ohne
Zweifel besitzt die Technik benehmende Momente — so in der reinen Geometrie
der Formen, in den Quadraten, Kreisen, Ovalen und Geraden, von denen man auf
den Autobahnen abweichen mußte, damit die Fahrer nicht einschliefen. Das gleiche
gilt für ihre Rhythmen — für ihre schnellen, brausenden oder singenden Takte,
für ihre im Gleichmaß wechselnden Schaltungen, für ihre fließenden Abläufe und
überhaupt für das gewaltige Wiegenlied ihrer Monotonie. Besonders wirkt das
dort, wo sie rein zur Anschauung spricht — wie in der Propaganda, die sich sowohl
im schroffen schwarzweißen Muster ihrer Formen als auch in ihrer monotonen Wiederholung
als eine der Gattungen der Technik ausweist. Die Besucher, die aus dem Lichtspiel
strömen, gleichen einer Menge von Erwachenden, und weun wir in die von mechanischer
Musik erfüllten Räume treten, teilt sich uns leicht ein wenig von der Stimmung
einer Opiumhöhle mit.
enommenheit Ohne
Zweifel besitzt die Technik benehmende Momente — so in der reinen Geometrie
der Formen, in den Quadraten, Kreisen, Ovalen und Geraden, von denen man auf
den Autobahnen abweichen mußte, damit die Fahrer nicht einschliefen. Das gleiche
gilt für ihre Rhythmen — für ihre schnellen, brausenden oder singenden Takte,
für ihre im Gleichmaß wechselnden Schaltungen, für ihre fließenden Abläufe und
überhaupt für das gewaltige Wiegenlied ihrer Monotonie. Besonders wirkt das
dort, wo sie rein zur Anschauung spricht — wie in der Propaganda, die sich sowohl
im schroffen schwarzweißen Muster ihrer Formen als auch in ihrer monotonen Wiederholung
als eine der Gattungen der Technik ausweist. Die Besucher, die aus dem Lichtspiel
strömen, gleichen einer Menge von Erwachenden, und weun wir in die von mechanischer
Musik erfüllten Räume treten, teilt sich uns leicht ein wenig von der Stimmung
einer Opiumhöhle mit.
Die beste Schilderung des vollautomatisierten Zustandes enthält die Erzählung
«Hinab in den Maelstrom» von E. A. Poe, den
die Goncourts in ihren Tagebüchern schon früh mit Recht als den ersten
Autor des 20. Jahrhunderts bezeichneten. Sehr gut wird darin unterschieden das
Verhalten der beiden Brüder, von denen der eine, vom furchtbaren Anblick des
Mechanismus geblendet, sich in bewußtlosen Reflexen bewegt, während der andere
sich denkend und fühlend verhält — und überlebt. - Ernst Jünger,
Gärten und Straßen (19. August 1939)
Benommenheit (2) Eine der wenigen,
die sich intensiv mit Persingers Arbeiten
auseinandersetzten, ist die britische Psychologin Susan Blackmore, die
sich die Erforschung parapsychologischer Phänomene
zum Ziel gesetzt hat. Nach einem Selbstversuch
in Persingers Labor meinte sie allerdings, das sei das Riskanteste gewesen,
was sie je gemacht hätte. «Es war, als ob mich jemand an den Schultern und Beinen
ergriff und meinen Körper verdrehte und auseinanderzog», beschrieb sie ihre
Erfahrungen unter Persingers Motorradhelm. Nacheinander durchlebte sie intensive
Zustände von Ärger, Wut und Angst,
und als sie schließlich die Kammer verließ, «da fühlte ich mich für Stunden
schwach und desorientiert».
Zu Recht warnt Susan Blackmore, daß niemand die Langzeitwirkungen magnetischer
Felder auf das Gehirn kenne. In der Abgeschiedenheit seiner Provinzuniversität
geht Michael Persinger derweil mit seinen Experimenten schon in die nächste
Stufe. «Das ist unser neuestes Gerät: der sogenannte Oktopus», sagt der Forscher
und deutet auf einen mit Klebeband umwickelten Kranz von acht Magnetspulen,
der den Probanden über den Kopf gestülpt werden soll. «Damit können wir das
Magnetfeld um den ganzen Kopf rotieren lassen und erzielen dadurch noch stärkere
Effekte», erläutert der Hirnforscher. «Hinterher sind die Leute allerdings wirklich
verwirrt, manchmal verlieren die Versuchspersonen
sogar das Bewußtsein.» Wie bitte? «Ach wissen Sie», beruhigt Persinger, «wenn
jemand stundenlang vor dem Fernseher sitzt, dann ist
er hinterher auch benommen.» - (kopf)
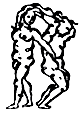 enommenheit Ohne
Zweifel besitzt die Technik benehmende Momente — so in der reinen Geometrie
der Formen, in den Quadraten, Kreisen, Ovalen und Geraden, von denen man auf
den Autobahnen abweichen mußte, damit die Fahrer nicht einschliefen. Das gleiche
gilt für ihre Rhythmen — für ihre schnellen, brausenden oder singenden Takte,
für ihre im Gleichmaß wechselnden Schaltungen, für ihre fließenden Abläufe und
überhaupt für das gewaltige Wiegenlied ihrer Monotonie. Besonders wirkt das
dort, wo sie rein zur Anschauung spricht — wie in der Propaganda, die sich sowohl
im schroffen schwarzweißen Muster ihrer Formen als auch in ihrer monotonen Wiederholung
als eine der Gattungen der Technik ausweist. Die Besucher, die aus dem Lichtspiel
strömen, gleichen einer Menge von Erwachenden, und weun wir in die von mechanischer
Musik erfüllten Räume treten, teilt sich uns leicht ein wenig von der Stimmung
einer Opiumhöhle mit.
enommenheit Ohne
Zweifel besitzt die Technik benehmende Momente — so in der reinen Geometrie
der Formen, in den Quadraten, Kreisen, Ovalen und Geraden, von denen man auf
den Autobahnen abweichen mußte, damit die Fahrer nicht einschliefen. Das gleiche
gilt für ihre Rhythmen — für ihre schnellen, brausenden oder singenden Takte,
für ihre im Gleichmaß wechselnden Schaltungen, für ihre fließenden Abläufe und
überhaupt für das gewaltige Wiegenlied ihrer Monotonie. Besonders wirkt das
dort, wo sie rein zur Anschauung spricht — wie in der Propaganda, die sich sowohl
im schroffen schwarzweißen Muster ihrer Formen als auch in ihrer monotonen Wiederholung
als eine der Gattungen der Technik ausweist. Die Besucher, die aus dem Lichtspiel
strömen, gleichen einer Menge von Erwachenden, und weun wir in die von mechanischer
Musik erfüllten Räume treten, teilt sich uns leicht ein wenig von der Stimmung
einer Opiumhöhle mit.










